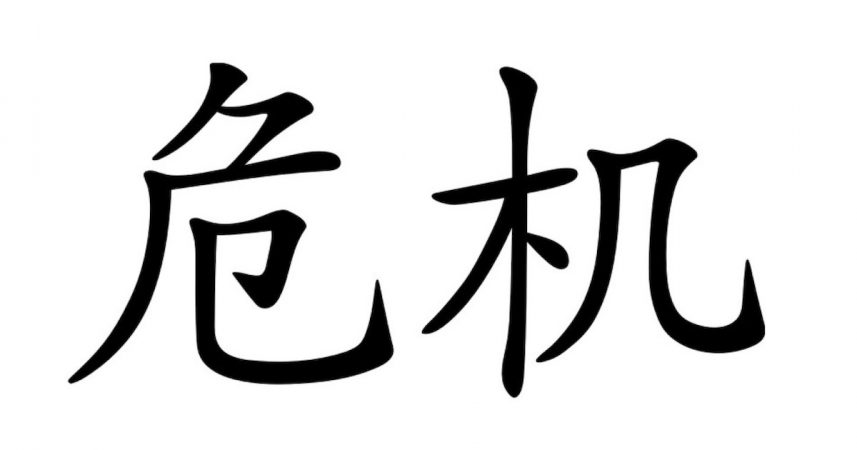Im Zuge der Corona-Krise fokussiert sich der Blick der Medien und der Menschen hierzulande zunehmend auf das eigene Umfeld. Soll heißen: Auf die großen sichtbaren Brandherde in den USA, in Europa und in China. Auf die wohlhabenden Länder also, die aktuell im Zentrum der Pandemie zu stehen scheinen. Doch der Nährboden der Pandemie – fortschreitende Urbanisierung und unzureichende Gesundheitssysteme – ist erst recht ein Menetekel vieler weniger wohlhabender Länder und Gesellschaften rund um den Erdball in Afrika, Asien und Lateinamerika. Ein Blick auf die größten und gleichzeitig am engsten besiedelten Megacities dieser Welt zeigt, dass die wahren Probleme der Pandemie für diesen Globus vielleicht erst noch bevorstehen. Zu den zehn bis 20 größten Städten dieser Welt (je nach Statistik) zählen etwa Kairo, Dehli, Jakarta, Kalkutta, Dhaka, Mexico City oder Manila mit jeweils mehr als zehn Millionen Einwohnern, ganz zu schweigen von den vielen anderen wachsenden Millionenstädten auf diesen drei Kontinenten. Dass der Virus erst mit Verzögerung dort ankommt, ist sicher einer der wenigen Vorteile dieser Länder, die nicht im Zentrum der globalen Reiseströme stehen – und sich erfreulicherweise nun bereits abgeschottet haben …
Doch die Experten sind sich sicher: Corona wird auch in diesen Megacities ankommen, wenn er nicht vielerorts bereits angekommen ist. Und damit wird er auf Länder, Städte und Menschen treffen, die ihm noch weniger entgegenzusetzen haben als die wohlhabenden Städter des globalen Nordens. Ganz langsam nehmen auch die Medien diese Gefahr zur Kenntnis. Die Süddeutsche Zeitung oder die Hilfsorganisation medico international etwa wiesen zuletzt in mehreren lesenswerten Beiträgen auf das Ankommen des Virus im globalen Süden hin. In einem SZ-Artikel über die Favelas in Brasilien treten die Probleme pars pro toto mehr als deutlich zu Tage. Die Enge der Favelas, die es auch in allen anderen Megacities gibt und die Abstand halten unmöglich macht. Der eingeschränkte Zugang zu Strom und Wasser, die oft nur wenige Stunden am Tag zur Verfügung stehen und den Aufruf zum Händewaschen ebenso ad absurdum führen wie das Betreiben von Beatmungsgeräten. Gesundheitssysteme, die stark privatisiert sind und vor allem den Starken im Lande helfen. Bemerkenswert allerdings auch eine Essay-Serie der Süddeutschen aus den Kapitalen Afrikas, welche nicht nur diese Probleme beschreibt, sondern für einmal auch darauf hinweisen, dass das mit Epidemien erfahrene Afrika nicht nur gefährdeter, sondern paradoxerweise auch chancenreicher ist. Es wird dort schneller und rigoroser reagiert, die Leid geplagten Menschen sind vorbereiteter und an Einschränkungen mehr gewöhnt. Gut zu wissen, dass es Afrikaner sind, die dies als Vorzüge nennen. Aus europäischen Federn könnte es schnell zynisch wirken. Bemerkenswert in diesem Zusammenhang auch, dass es Afrikaner sind, die in diesem Zusammenhang die Frage stellen, warum niemand nach den Erfahrungen des Kontinents mit solchen Epidemien fragt …