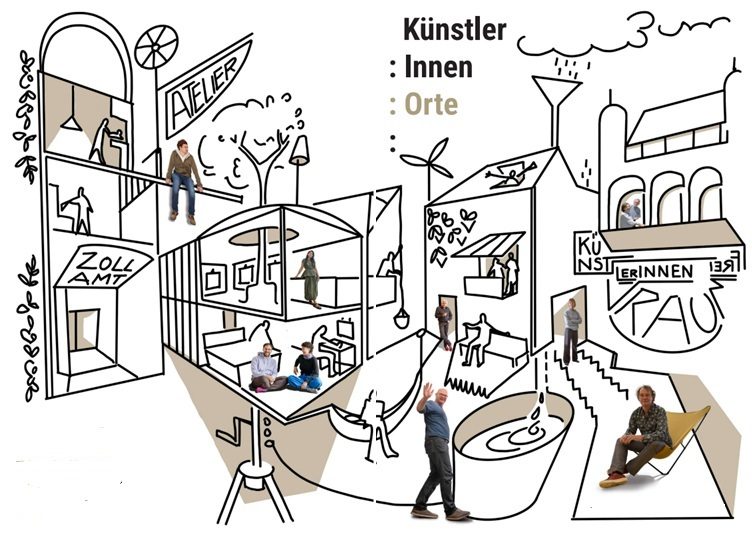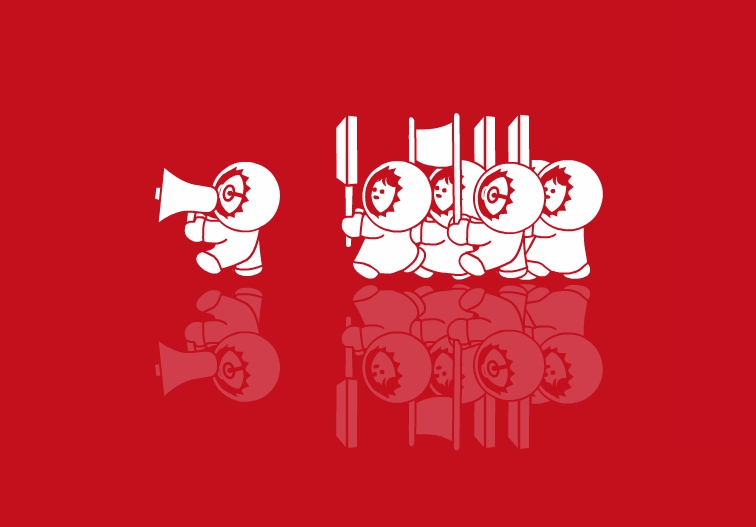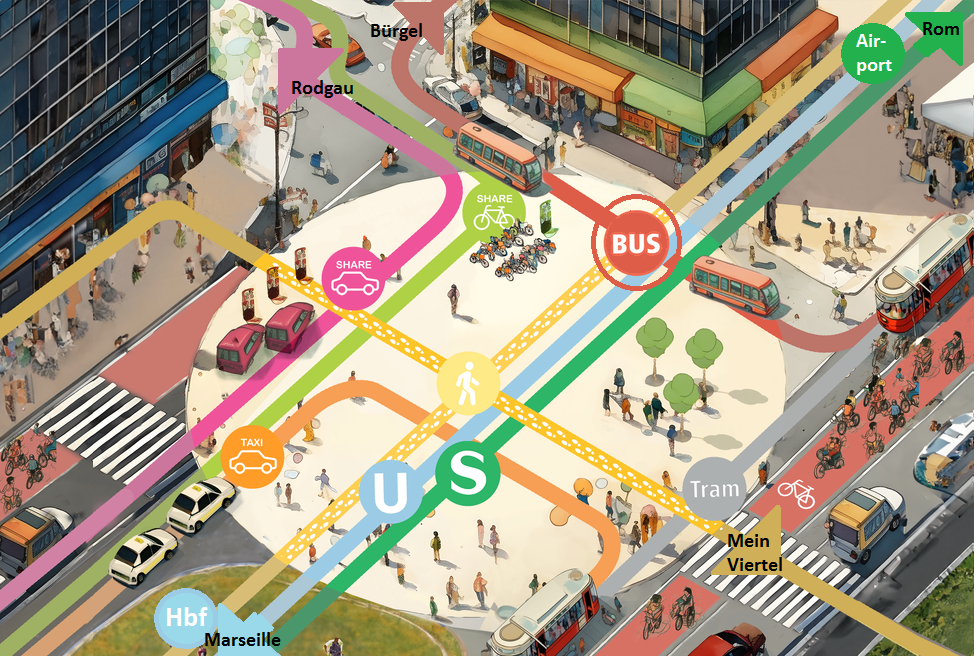In der »Wäscherei« in Offenbachs Dornbuschviertel ist es gerade recht eng in Schaufenster und Empfangsraum. Doch nicht, weil gerade besonders viele Menschen besonders weiß gewaschene Hemden haben wollen. Nein. Fische, soweit das Auge blickt. Und sonstiges Unterwassergetier. Und Menschen, die nach all diesem Getier Schlange stehen. Kunststück. Die »Wäscherei« ist bekanntlich schon lange keine Wäscherei mehr. Sondern ein Atelier- und Ausstellungsraum. Und das »Aquarium« mit dem Getier, das sich wie in einer Unterwasserlandschaft zwischen zwei Geigenfeigen ausbreitet, ist eine Ausstellung. Genauer: eine Benefiz-Ausstellung zugunsten eines Hospizes. Und die Tiere? Sie sind unisono aus Wolle …
Angeschwemmt wurden die Meeresbewohner durch die Aktivitäten der Facebook-Gruppe »Acta non Verba – Von Freunden für Freunde«, welche in der Ausstellung vornehmlich selbstgemachte Wolltiere präsentiert. Vom Anemonenfisch über Hammerhai und Korallen bis hin zum Anglerfisch oder dem sehr begehrten schielenden Rochen. Und all diese Gefährten kann man/frau angeln. Also genauer: gegen eine Spende erwerben. Nachdem bereits im vergangenen Jahr bei einer ähnlichen Aktion vor Ort der Erlös von gut 2.000 Euro in Form eines Sessels für den Aufenthaltsbereich einer Palliativstation gespendet wurde, geht der komplette Ertrag in diesem Jahr an das Kinderhospiz Sterntaler in Heppenheim. Auch diese Aktion läuft gut. Schon kurz nach der Eröffnung lagen die Spenden wieder im vierstelligen Bereich. Und noch ist das »Aquarium« bis Ende Februar zu sehen (wobei die geangelten Tiere bis dahin übrigens vor Ort verbleiben).
»Wir wollen Freude schenken«, sagt Sabine, ein Mitglied der Gruppe. Es gehe darum, wie man selbst etwas tun und die Welt ein wenig positiv verändern könne. Und darum, den Besucher*innen der Ausstellung bei deren Betrachtung ein Lächeln ins Gesicht zu Zaubern. Was bei der Vernissage Mitte Januar leicht oder oft gelungen war. »Acta non Verba!« besteht aus verschiedenen handarbeitsaffinen Menschen deutschlandweit. Natürlich hat jedes Mitglied eigene Vorlieben. So möchten manche einfach Socken stricken, andere etwas für Frühchen. Und manche eben auch mal witzige Meeresbewohner*innen. Es gibt so genannte Herzensprojekte, die regelmäßig »bedient« werden. Und dann wiederum Jahresprojekte, deren Erlös einmalig an eine bestimmte Einrichtung geht. Alle Orte, an denen sich die Aktionen abspielen, eint, dass sie Mitgliedern bekannt und vertraut sind und von diesen vorgeschlagen werden. Die Kreativen spenden ihre Zeit, ihre Arbeit und teils sogar das benötigte Material. Die erzielten Spenden gehen sodann eins zu eins an die gewählte Einrichtung. Nicht immer müssen Erwerber*innen allerdings direkt vor Ort sein. Meist gibt es noch eine Facebook-Seite zum Angeln von außerhalb. Ach ja: Sachspenden werden ebenfalls gerne entgegengenommen. Wer etwa zuhause noch Wollreste von Eltern und Großeltern hat, kann sie gerne bei einer Gruppe vor Ort vorbeibringen. Auch dies schenkt Freude … (ver.).