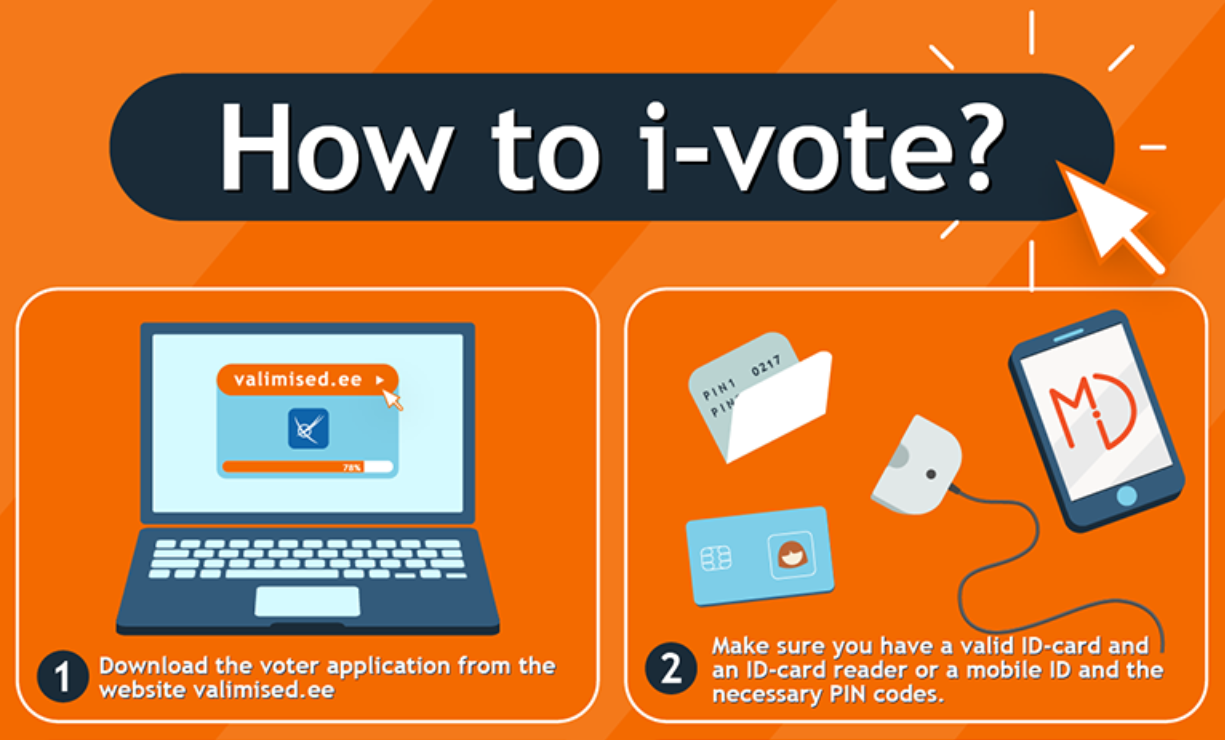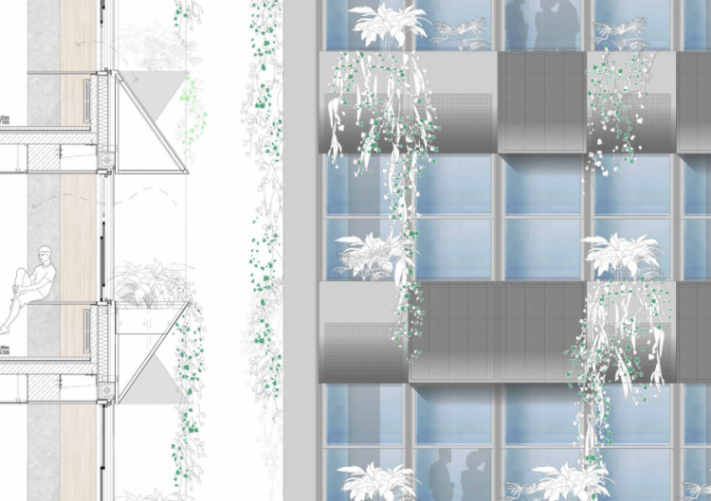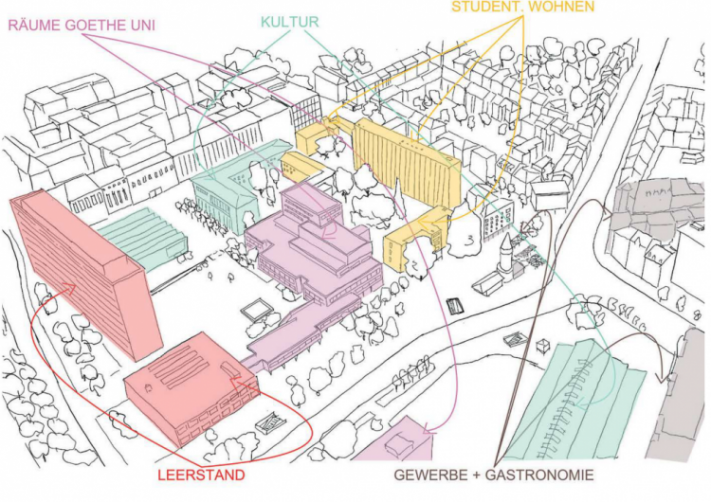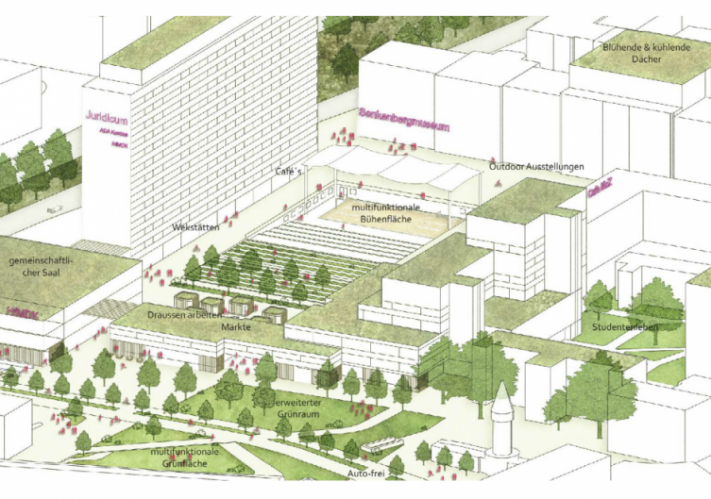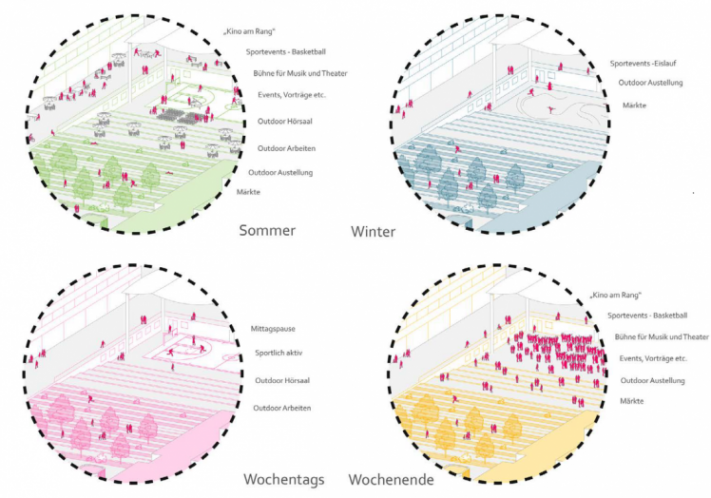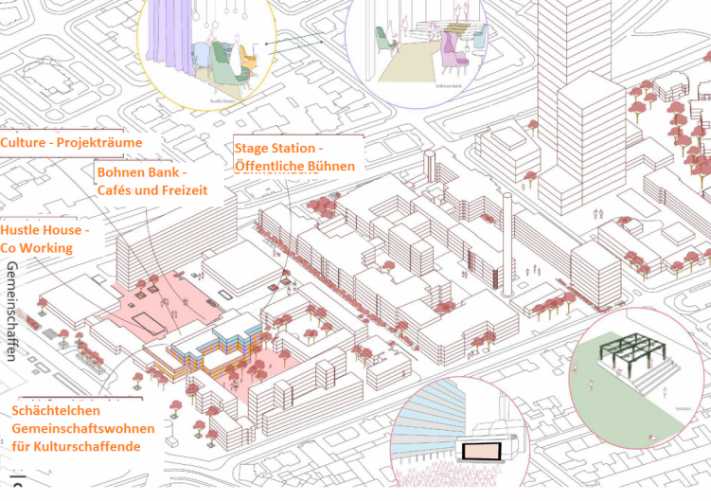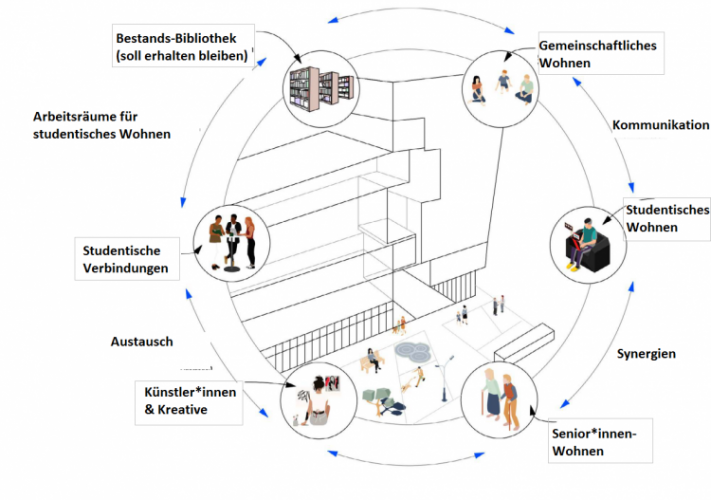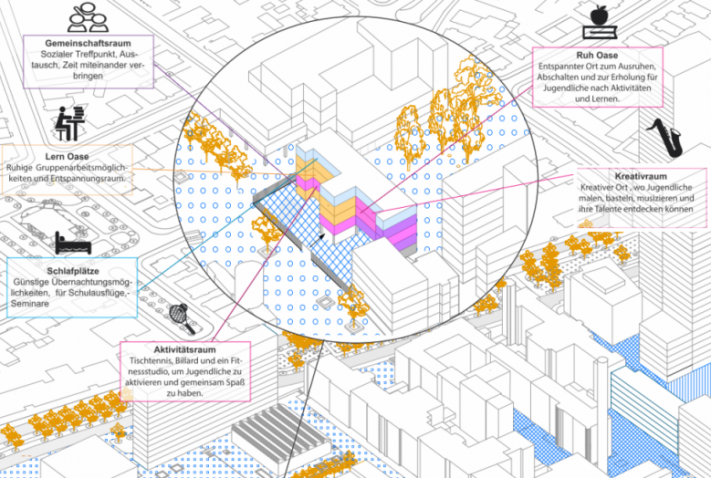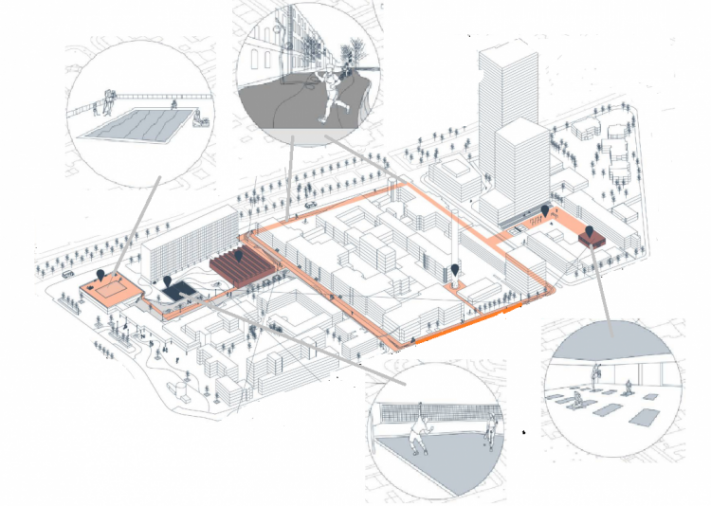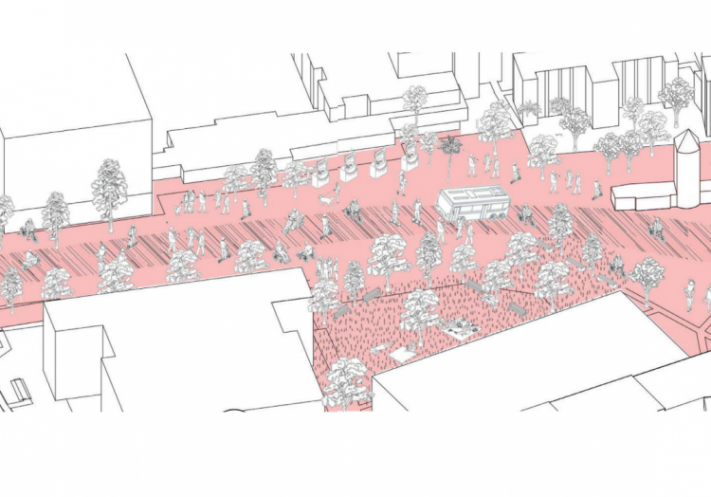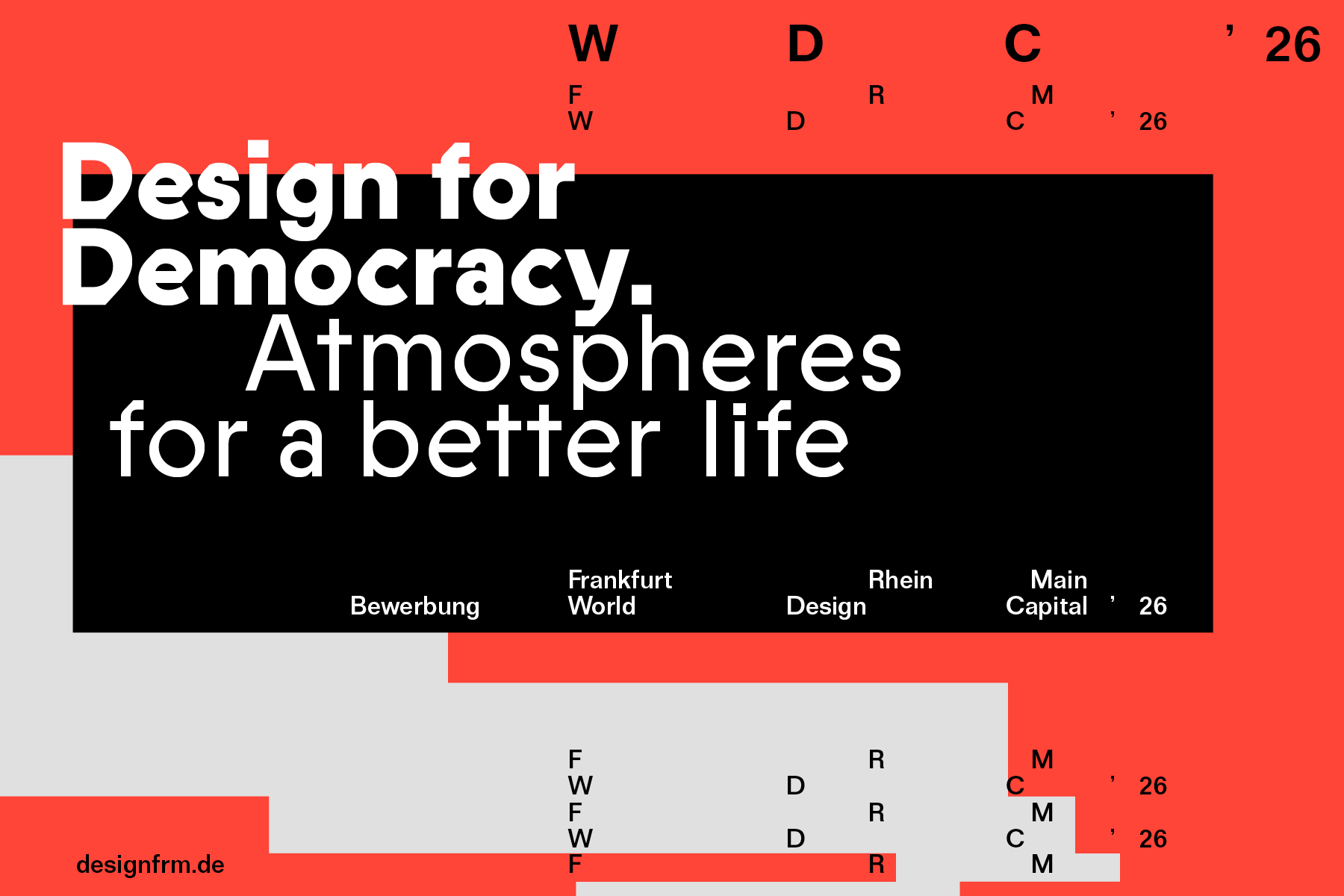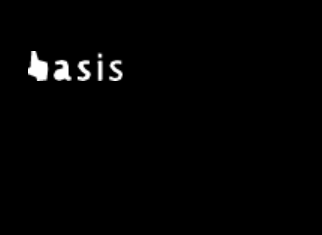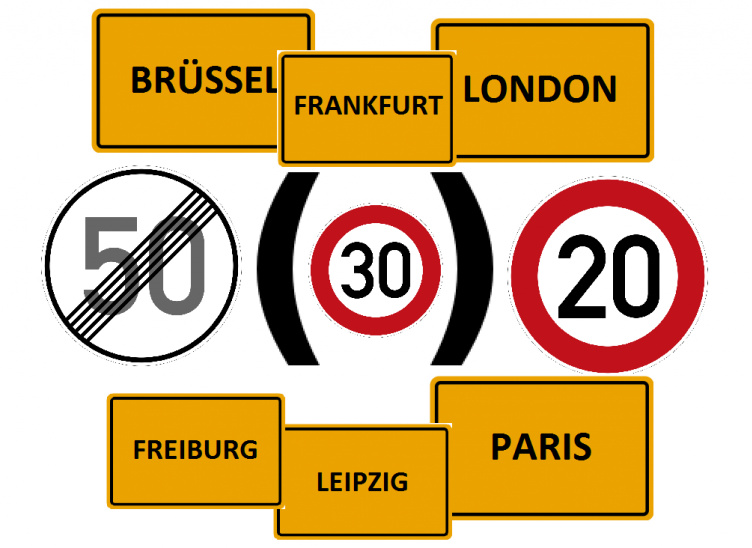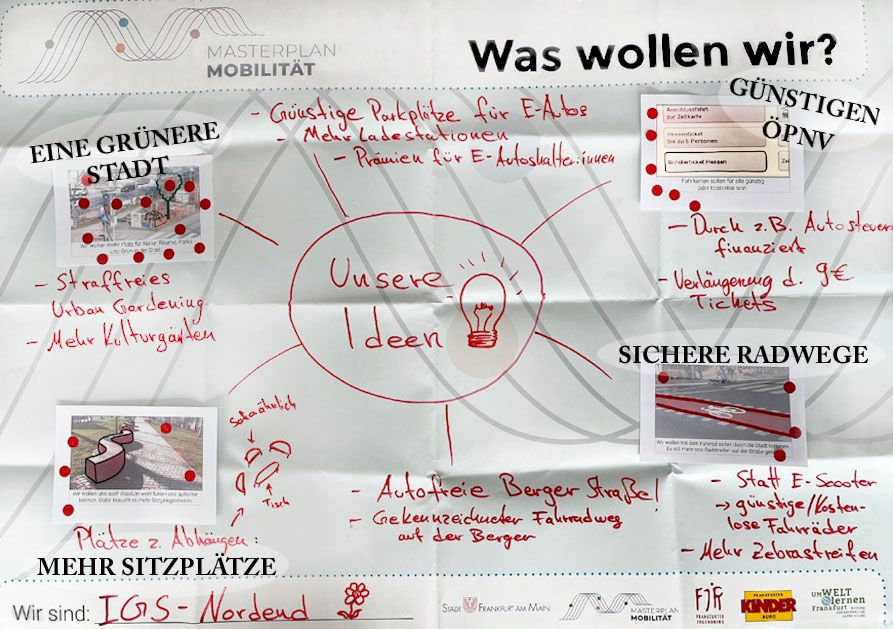Eigentlich könnte Nazim Alemdar die berühmte Atlas-Figur des Bildhauers Gustav Herold, die auf der Spitze des Hauptbahnhofes steht, aus dem Schaufenster heraus sehen. Eigentlich. Denn die Fensterfronten seines weit über Frankfurt hinaus bekannten Kultkiosks »Yok Yok«, der sich auf der gegenüberliegenden Straßenseite an der Adresse Am Hauptbahnhof 6 befindet, sind mit Aufklebern übersät. Aufkleber, die Kunden und Passanten daran aufgebracht haben. »Das hat sich so schon am alten Standort in der Münchner Straße entwickelt«, erzählt Alemdar. Als sie im vergangen Jahr mit ihm und dem Kiosk an den Hauptbahnhof gezogen seien, ging es dort mit den Aufklebern weiter. Täglich schaue er aber, dass an den Schaufenstern nichts klebt, was in irgendeiner Weise dem rechten Spektrum zugeordnet werden könne. »Hier«, so Alemdar, »gibt es keinen Platz für Nazis und für Dealer«. Das Yok Yok sei ein Ort, der offen ist für alle, die offen sind …
Die »Sticker-Wall«, wie sie heißt, bekommt auch an diesem Tag »neues Futter«. Alemdar, den alle nur Nazim nennen, steht hinter dem Verkaufspult im Kiosk, in dem 22 Kühlschränke mit Getränken vor sich hin brummen. Obwohl es noch früher Nachmittag ist, schauen bereits viele Gäste vorbei und unterhalten sich mit dem Inhaber, den die meisten seit langem kennen, quasi mit ihm und seinem Kiosk an den Hauptbahnhof »umgezogen« sind – Menschen unterschiedlicher Berufe und gesellschaftlicher Schichten, Künstler*innen, Studierende, Banker, Anwälte, Eintracht-Fans oder einfach Reisende. Die Gäste, wie er sie nennt, sind für ihn auch Familie. Nicht wenige sehen es ähnlich. Respekt begleitet ihn, wenn er hier, am vielleicht schwierigsten Punkt des schwierigen Bahnhofsviertels vor die Tür tritt. Einige verweilen an dem Nachmittag an den Tischen, die direkt vor der Tür stehen – mitten im Trubel, der rund um den Bahnhof herrscht und genießen die zugleich besondere Atmosphäre des Ortes und des Viertels. Das »Yok Yok«, was aus dem Türkischen übersetzt so viel heißt wie »Gibt’s nicht – gibt’s nicht«, ist ein Treffpunkt, ein Ort, an dem Begegnung und Austausch möglich ist, aber auch ein Platz, der zeigt, dass das Bahnhofsviertel nicht nur Kriminalität und Drogenkonsum ist. Und: eine Institution, obwohl erst Monate an dieser Stelle …
Auch »Nazim« ist eine Institution. Jemand, der Menschen zusammenbringt. Verbindet. Ein Gefühl für Orte hat. »Die Tische, die draußen stehen«, so Nazim, »stammen noch aus einem alten Fischgeschäft aus der Münchner Straße. Die waren ganz früher sogar mal Hoflieferant«, erzählt Alemdar, der Ende der 1970er Jahre nach Deutschland kam und das Bahnhofsviertel sehr gut kennt. In früheren Jahren habe er dort einen Großhandel für VHS- und Musikkassetten gehabt und habe die Produkte von Kopenhagen bis nach Sydney vertrieben. Das Internet habe aber alles verändert. Aber am Ende auch dazu geführt, dass er das »Yok Yok« in der Münchner Straße eröffnet habe. Als Vorsitzender des im Bahnhofsviertel ansässigen Gewerbevereins macht er sich für ein Miteinander im Viertel stark. Dafür, dass sich Menschen mit Respekt begegnen. Die Menschen schätzen seine offene Art, auf jeden zuzugehen und sie miteinander zu verbinden, durch Gespräche. Und durch die Kunst, die auch in den Räumen am Hauptbahnhof ihren Platz gefunden hat – in der »Treppengalerie«, wie er sie selbst nennt, hinter dem Verkaufsraum. Kunst – und das dürften längst nicht alle seiner Gäste hier im Schatten des Hauptbahnhofs wissen – gehört zu Nazim wie Kiosk. Ausstellungen haben im »Yok Yok« Tradition. Gerade denen, die nicht in Museen hängen, gab er schon immer Raum. Und sei es nur eine Wand. Bereits in der Münchner Straße, wo er 2008 eröffnet hatte, gehörte die Kunst mit dazu, ließ er Wände bespielen. Legendär seine Dependance in der Fahrgasse. Mitten in der Frankfurter Galerienstraße mischte er einen etwas besseren Kiosk mit einem Kunstort. Jeder Zentimeter Wand wurde zur Ausstellungsfläche: Fotografien, Zeichnungen, Malerei. In einem sehr viel feineren Ambiente, auf den dunkelgrünen Wänden, mit dem Schreibtisch als Theke, den Fensterbänken als Sitzgelegenheit. Auch Konzerte in Anlehnung an die 1920er gab es dort. Ein Hauch von Bohème. Fast eine Ironie des Schicksals, dass er ging, als sich in der Galerienstraße die Cafés, Eisdielen und Biertastings ausbreiteten. Ein Hauch dessen, was die Fahrgasse war, ist auch wenige Meter vom Yok Yok entfernt, das lauschige Parkcafé Yok Yok Eden, das er mitinitiiert hatte, wenn auch nicht selbst betreibt. Auch dort gab es Musik und Lesungen unter Bäumen. Was die Ausstellungen anging, seien es rückblickend wohl bisher an die 70 Schauen gewesen – und das soll immer weitergehen. Viele Frankfurter Künstler wie den 2018 verstorbenen Max Weinberg habe er in den vergangenen Jahren gezeigt. »Ich fühle mich auch als ein Teil der Frankfurter Kunst- und Kulturszene«, beschreibt er es. Viele aus dieser Szene würden das sofort unterschreiben. Paradox: Sein Name steht wahrscheinlich in keinem Kunst- und Kulturführer der Stadt. Und doch hat er mehr Frankfurter Künstler*innen Raum gegeben als viele Bekanntere. Und das mit sehr bescheidenen Mitteln. Nur mit viel Wohlwollen …
»Deutschland hat mir viel gegeben und ich habe hier ein tolles Leben«, betont Nazim Alemdar. »Volles Leben« wäre wohl auch nicht falsch. Für ihn sei es aber wichtig, auch wieder etwas zurückzugeben. Sein Credo laute, alles, was er mache, von Herzen zu tun und Negatives in Positives umzuwandeln und aktiv mitzugestalten. Was die Drogenproblematik im Viertel betreffe, so wünsche er sich ein Frankfurter Modell 2.0., unter anderem mit mehr sicheren Räumen für den Konsum. Es sei außerdem wichtig, die Integration stärker zu fördern und nicht immer nur zu fordern. Sagt’s und geht raus und zeigt uns, was »wir« hier um die Ecke in der Kaiserstraße gerade wieder alles vorhaben. Weniger Autos, mehr Sicherheit, Sitzgelegenheiten – Kleinigkeiten, für die er sich tagein, tagaus einsetzt. Rührig im besten Sinne. Viele Politiker*innen reden gerne, was sie im Bahnhofsviertel tun (würden). Alemdar handelt. Einen Traum, den hat er noch. Ihn erzählt er, wer ihn lange kennt. »Ein, zwei Jahre eine Halle, ein altes Gebäude bespielen. Muss nichts besonderes sein. Für einen Platz, an dem Menschen sein können, reden, tanzen, Kunst sehen, trinken …«. Noch hat er einen passenden Ort noch nicht gefunden … (alf.).