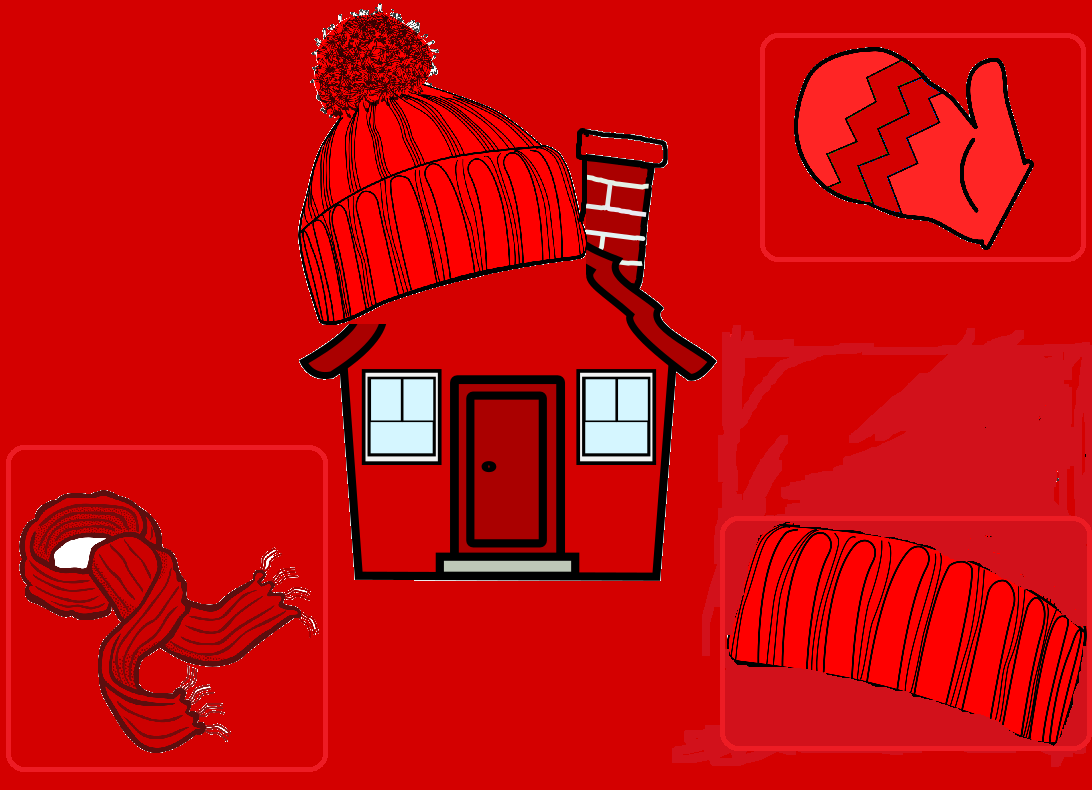Auf der Webseite »Solidarische Landwirtschaft« findet man aktuell rund 400 »SoLaWis« in Deutschland (dazu bald 100 weitere in Gründung). SoLaWi boomt. Und warum auch nicht? Das Prinzip ist bestechend: Landwirt*innen in der Region produzieren, Verbraucher*innen nehmen direkt ab und beteiligen sich bedingt auch am Risiko. Es wird Obst und Gemüse produziert, manchmal auch Eier und Honig, seltener Milch und Fleisch. Die Produkte kann man abholen oder sich umweltfreundlich liefern lassen. Sehr häufig liegen SoLaWis in oder nahe Ballungsräumen – wo die Städter*innen dann beim exotisch geworden Landleben nicht nur mitreden, sondern bei gemeinsamen Pflanz-, Jät- und Ernteaktionen auch gerne selbst die Ärmel hochkrempeln und mit anpacken können. Wenn sie denn wollen …
Ein schnelles Googeln ergibt in Frankfurt und naher Umgebung gleich neun SoLaWis: SoLaWi Frankfurt, SoLaWi Maingrün, SoLaWi Ffm, SoLaWi Guter Grund, SoLaWi Luisenhof, SoLaWi 42, der Birkenhof Egelsbach, Auf dem Acker und Die Kooperative. Auch in Frankfurt, der engen, von Banken und Börsen regierten Hessenmetropole, und der aus allen Nähten platzenden, verkehrszerfurchten Rhein-Main-Region gibt es also Raum für sowas. Ein Sechstel des Frankfurter Stadtgebiets (4000 Hektar, also 40 Quadratkilometer!) ist landwirtschaftliche Fläche. In der Metropolregion FrankfurtRheinMain sind es sogar 42 Prozent – reichlich Platz also nicht nur für die übliche marktorientiert-produzierende konventionelle Landwirtschaft, sondern auch für viele Direktvermarkter und SoLaWis. Eine davon ist die 2018 gegründete, schnell und pragmatisch wachsende »Kooperative« mit ihrer Demeter-zertifizierten »Cityfarm« in Oberrad sowie weiteren Flächen des Quellenhofs in Steinbach. Sie versorgt bereits 550 Frankfurter Haushalte mit diversen Angeboten (groß/klein, Obst und/oder Gemüse, mit/ohne Eier etwa). Wobei für einen kleinen Haushalt mit einer kleinen Obst-Gemüse-Kiste, ein paar Eiern und, nicht zu vergessen, zwei Hühnern im Jahr etwa 25 bis 30 Euro die Woche plus/minus anfallen können (ohne Gewähr natürlich). Das eigene Sortiment der Kooperative wird durch Kooperationen mit anderen Höfen noch erweitert. Wenn nicht gerade Corona ist, kann man auch mitmachen. Man kann Obstbäume pflanzen, mitgärtnern und -imkern, Marmelade kochen oder Sauerkraut herstellen. Es gibt Kinderkurse, Pflanz- und Ernte-Tanz-Feste, Schnittkurse, aber auch Versammlungen, zahlreiche Dialogprozesse, ein Online-Forum und vieles mehr. Kommunikation und das gemeinsame Beschließen ist allen SoLaWis sehr wichtig. Doch man kann sich natürlich auch einfach nur wöchentlich die per Fahrradkurier direkt vom Feld ins Depot gelieferte Kiste abholen, ein bisschen mit anderen Abholer*innen schwatzen und hin und wieder nach Oberrad radeln, um die zutraulichen Hühner in ihrem Hühnermobil auf der grünen Wiese zu besuchen.
SoLaWis gibt es in Deutschland schon seit fast 50 Jahren. Ursprünglich kam die Idee aus Japan. Dort schlossen sich 1974 engagierte Landwirt*innen und Verbraucher*innen im Kampf gegen Agrarchemie und Kunstdünger zusammen und »erfanden« so diese Form der Direktvermarktung und -gewinnung. Sie basiert auf gegenseitigem Vertrauen zwischen Erzeuger*innen und Verbraucher*innen, garantiert letzteren gesunde Nahrungsmittel mit geringem ökologischem Fußabdruck durch Produktion und Transport, viel Mitsprache und heute oft auch viel Mitmachen. Die Landwirt*innen können ihrerseits wegen der garantierten Abnahme und Bezahlung ihrer Produkte durch die mehr oder weniger straff organisierte Gruppe frei von Marktzwängen arbeiten. Mögliche Risiken, etwa durch Ernteausfälle, werden gemeinsam getragen – solidarisch eben. Damit steht SoLaWi, die solidarische Landwirtschaft, nicht nur zum gegenteiligen Vorteil, sondern meist auch zum Nutzen der Umwelt – denn hier wird meist aus Überzeugung ökologisch gewirtschaftet (juk.).