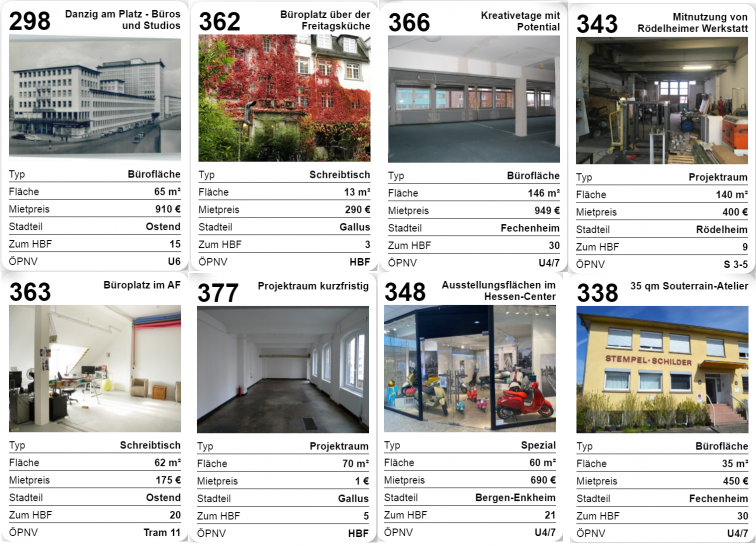Ein Atelierhaus für Künstler*innen, eine Agentur zur Vermittlung von Räumen an Kreative, Bücher über Orte möglichen Wohnens (und Arbeitens), Beratung für Städte und Stadtobere, eigene Aktionen und Ausstellungen – Jakob Sturm denkt und schafft seit vielen Jahren Räume für eine urbane Kultur der Stadt. »Frei-« und »Denkräume« inklusive. Er schafft Möglichkeiten en gros und verändert subtil und weniger subtil …
»Ich mach’ das, damit etwas passiert«. Der Satz klingt banal. Und doch steckt darin das gesamte Credo Jakob Sturms. »Machen« ist das, was er seit zwei Jahrzehnten in dieser Stadt macht. Oder mit dieser Stadt. Und »Denken« – ebenfalls in, über und sogar mit ebenjener Stadt. Herausgekommen ist bereits vieles: das Atelierhaus Basis mit über 100 Räumen für Künstler*innen und Kreative oder die Leerstandsagentur Radar mit Dutzenden neuen Kreativ-Räumen und Fördergelder für Umbau und Gestaltung obendrein. Doch damit hört er nicht auf zu denken und zu machen. Basis und Radar waren gestern, heute denkt er weiter: über Wohn- und Atelierhäuser – über neue Formen von Wohnen und Leben und Arbeiten eben. Und fast ist auch das wieder gestern, ist doch das erste davon in Praunheim schon entstanden. Und nein, auch das reicht nicht. Er denkt – und macht – auch Stadt anders, mischt vielfach mit, berät und stößt an, mit Ausstellungen, Fotoserien, vor allem aber eigenen Installationen, die selbst oft Räume beschreiben wie andere Jugendherbergen, neue Wohnformen in Büroetagen oder das einst gegründete Kunstbüro, in dem erst recht drinnen steckt, dass Kunst etwas Vermittelndes hat …
Wobei im Wort »vermitteln« auch »die Mitte« steckt. Künstler*innen verortet er mitten im Leben, nicht im Elfenbeinturm, sondern im Bahnhofsviertel der Stadt. Trotzdem – oder gerade deshalb – sieht er Kunst und Künstler*innen auch als Avantgarde, Stadt und Gesellschaft neu und weiter zu denken. Räume zu öffnen für Menschen (die keine Künstler*innen sind), über ihre Stadt und ihre Gesellschaft nachzudenken. Und Stadt und Gesellschaft dabei auch zu verändern – sofort oder schleichend oder stetig. Gleichsam Humus und Avantgarde, mit ihrer eigenen Nähe des Mittendrinseins und der Distanz des Andersseins der Künstler*innen (weswegen er auch dafür kämpft, Künstler*innen Raum in der (Innen-) Stadt zu geben). »Ich möchte, dass ein Raum entsteht, dass etwas geschieht, dass etwas geschehen kann, möglich wird«. So könnte er es über »Making Frankfurt« schreiben, einen seiner jüngsten Mitmachorte. Und so steht es in seinem Buch »Orte möglichen Wohnens«. Klingt intellektuell, ist aber auch wieder ganz banal. Für einen Menschen, der Räume schafft, reale und Denkräume – und reale Räume zum freien Denken. Seit Jahrzehnten und immer fort und immer weiter. Damit ist Sturm zugleich ein Beispiel dafür, einfach zu machen – weil eben sonst nichts passiert. Und so macht er weiter: Stadt und Kunst und Kultur und Denken. Längst nicht mehr nur in Frankfurt. Am einen Tag ist er in Kassel, am anderen in Gießen, dann wieder in Wiesbaden. Für das Land berät er die Städte, Räume für Kreative zu schaffen. Und im Idealfall auch neue Denkräume, um Neues in den Städten zu schaffen. Dazwischen trifft er im eigenen Hause (egal, welches von denen es in dem Moment gerade ist), Kulturförderer von Staat, Stadt oder Stiftungen, um neue Räume in den vorhandenen Räumen zu schaffen, etwa mit neuen Atelierprogrammen aus neuen Fördertöpfen. Ist das alles noch Kunst? Ja, sagt er, denn Kunst ist ja Denken, Machen, Verändern. Gutes zieht Gutes nach sich, sagt ein altes Sprichwort. Bei Sturm scheint Machen Machen nach sich zu ziehen. Oder genauer: Machen scheint Passieren nach sich zu ziehen. Ach ja: Sturm weiß seit vier Jahren, dass er Parkinson hat. Für ihn ein Grund, erst recht weiter zu denken und weiter zu machen … (sfo. / vss.).