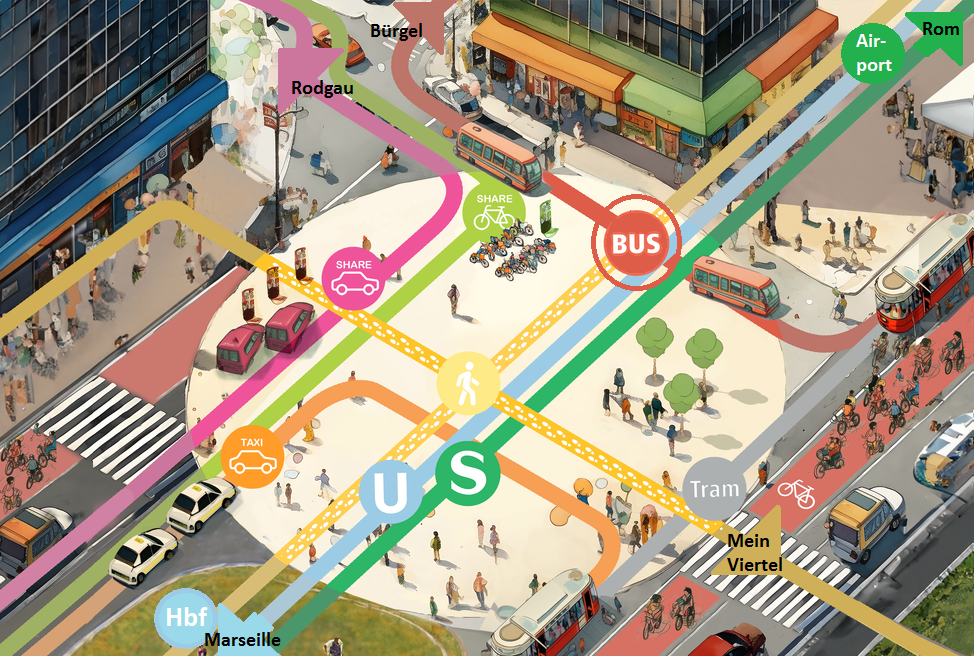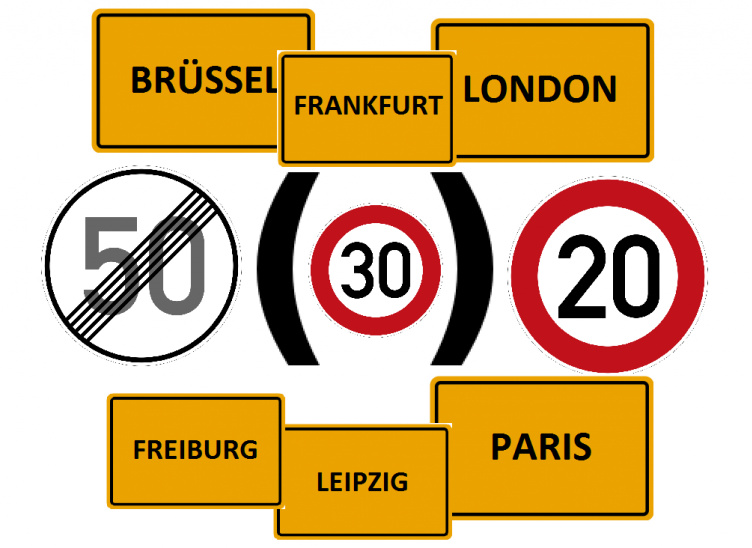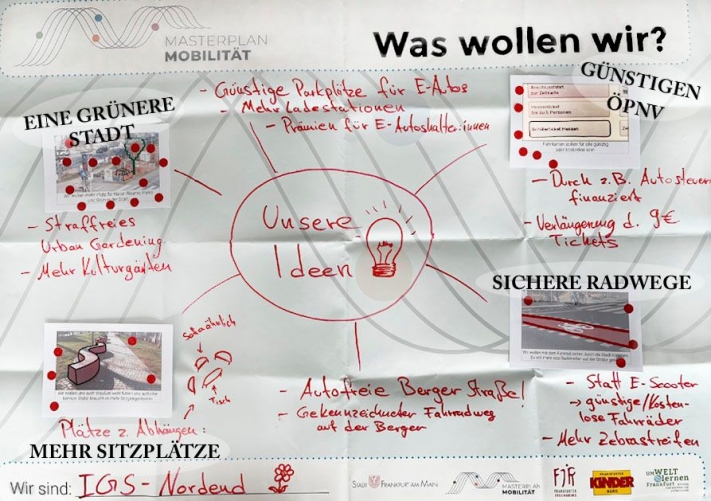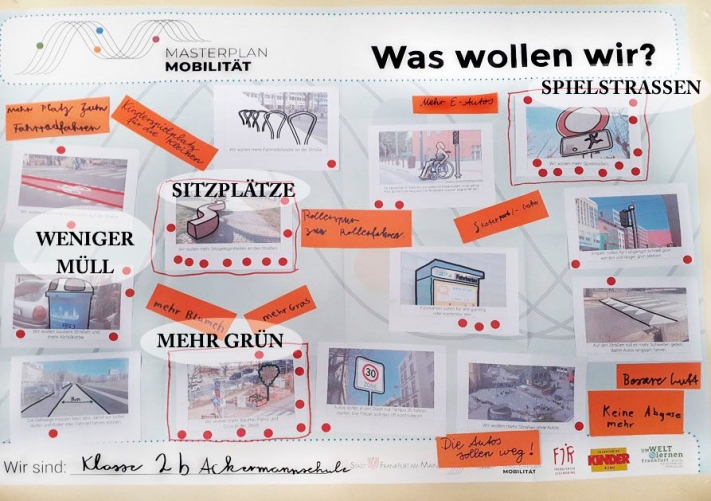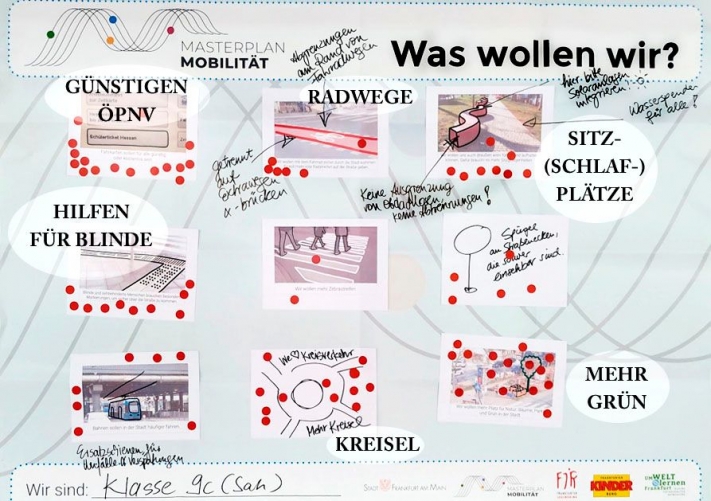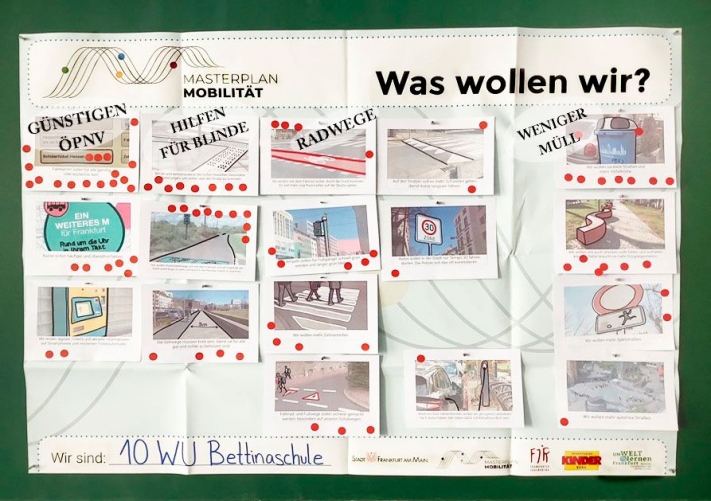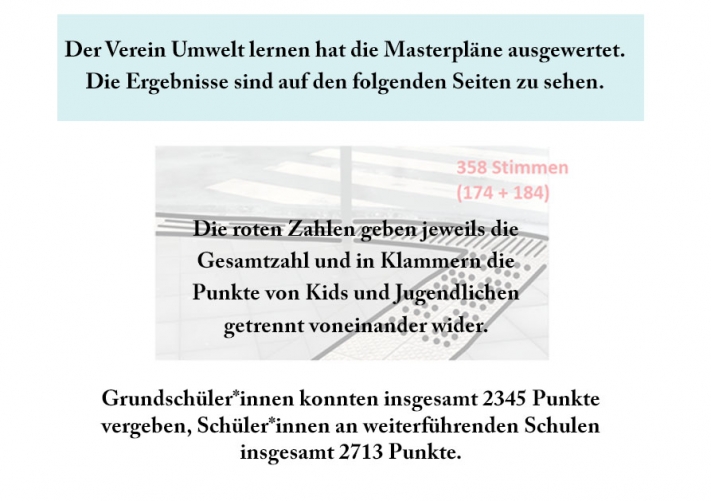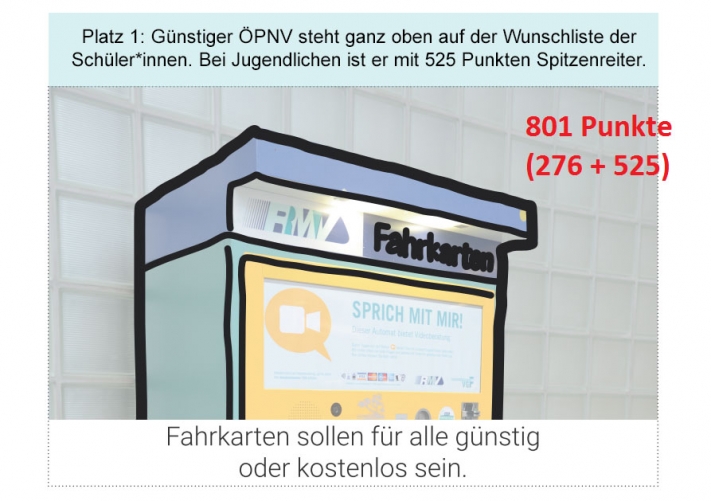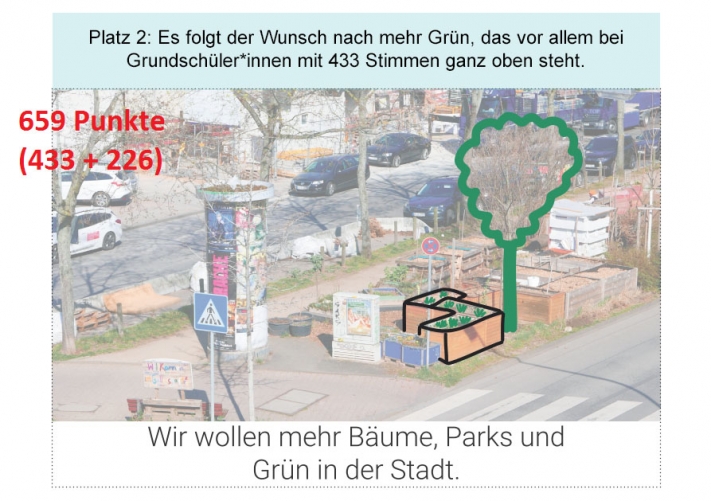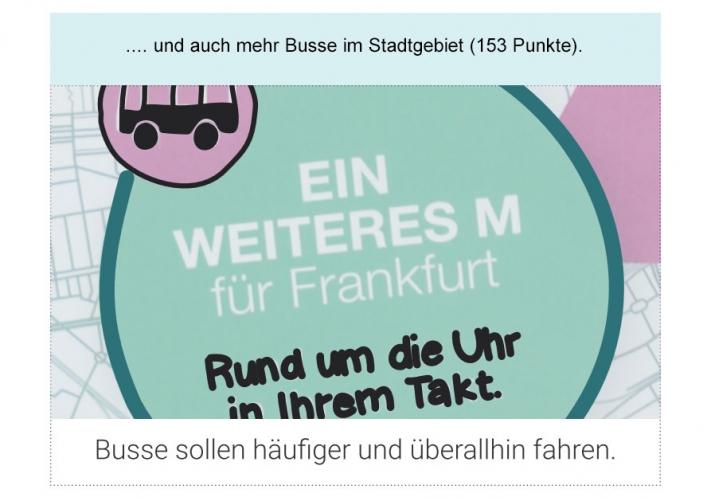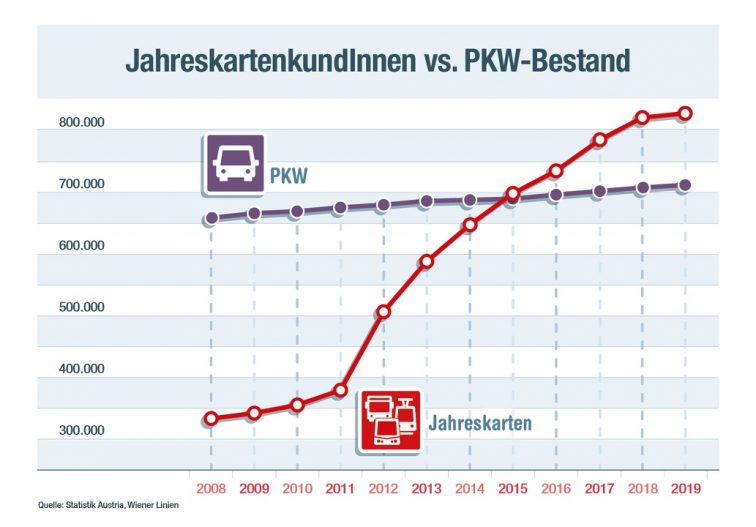rmv macht erfinderisch ...
Quelle: Barbara Walzer©
»Sind Sie sicher, dass Sie aus der Bahn später auch wieder rauskommen?«. Wer beim Einstieg in der Straßenbahn vom Fahrer erst einmal diese Frage hört, stutzt wohl zuerst einmal. Wer allerdings gerade versucht, mit einem Rollstuhl in die Straßenbahn zu kommen, könnte diese Frage schon öfter mal gehört haben. In der Tat ist es für Rollstuhlfahrer*innen keineswegs sicher, aus jeder Bahn, in die sie eingefahren sind, auch wieder herausrollen zu können. Bei zahlreichen Straßenbahnen gelangt man mit einem Rollstuhl nicht so leicht vom »Einstieg« auf einer Seite zum (späteren) »Ausstieg« auf der anderen, da diese oft nicht gegenüber liegen. Nicht selten ist da dann ein Umweg von mehreren Stationen nötig, um wieder aussteigen zu können. Da verbuchen es Rolli-Fahrer*innen schon als »freundlich«, wenn der Fahrer eigens ankam und sie darauf aufmerksam machte …
Oft reicht es, sich mit einem einzigen »Menschen mit Mobilitätseinschränkung« zu unterhalten (oder sich mit ihm auf den Weg durch die Stadt zu machen), um genug Stoff für Artikel wie diesen zu erhalten. Dass ebensolche Menschen mit Einschränkungen – also etwa Blinde und Rolli-Fahrer*innen – im ÖPNV oft noch weitere Einschränkungen gratis zu ihrem Alltag hinzu bekommen, ist keine Seltenheit. Paradox daran ist, dass das (Personenbeförderungs-) Gesetz seit 1. Januar diesen Jahres vorschreibt, dass es viele solche Behinderungen gar nicht mehr geben dürfte. Bahn- und Busangebote sollten etwa seit diesem Datum weitgehend barrierefrei sein. Immerhin: In Frankfurt muss nur noch eine U-Bahn-Station komplett barrierefrei umgebaut werden (die Station am Niddapark). Die schlechte Nachricht: Es müssen noch ungefähr die Hälfte der 717 Bus- und der 137 Straßenbahnstationen im Stadtgebiet angepasst werden. Da man aktuell nur rund 20 Stationen pro Jahr schafft, lässt sich leicht ausrechnen, wie viele Jahre bis Jahrzehnte es noch dauert, bis Blinde, Gehbehinderte und sonstig mobilitätseingeschränkte Personen in der Mainmetropole zumindest theoretisch uneingeschränkt am ÖPNV teilnehmen können. Theoretisch deshalb, weil dies auch voraussetzen würde, dass alle Aufzüge und Rolltreppen funktionieren, alle Einstiegsklappen für Rollis in Bussen ebenso und dann vielleicht auch noch die neuen Rufbusse an die Vorschriften angepasst sind. Von letzteren gibt es beispielsweise drei im Frankfurter Norden. Genau einer davon ist behindertengerecht. Wenn der einmal in der Wartung ist, gibt es eben keinen …
Die ehemalige Behinderten-Vertreterin im Frankfurter Fahrgastbeirat, Petra Rieth, sprach denn auch mal von einem »Schweizer Käse«: Substanz, aber viele Löcher. Ihr Nachfolger, Hannes Heiler, sieht immerhin leicht sarkastisch einen »Fortschritt«: Es habe sich einiges getan. Man könne nicht mehr einfach nur kritisieren, sondern müsse heute »differenziert kritisieren«. So bemerkt er schon, dass die Frankfurter Verkehrsgesellschaft VGF sehr bemüht sei. Abenteuerlicher werde es, wenn man in die Region wolle. Vor allem dann, wenn die Deutsche Bahn beteiligt sei. Da gäbe es nicht wenige Aufzüge und Rolltreppen, die über Wochen unbenutzbar seien. Doch auch in Frankfurt liegt vieles im Argen. Zwar sind neue Waggons vorhanden oder bestellt, um künftig Rollstühlen, Kinderwagen und Fahrrädern (deren Besitzer*innen sich alle im gleichen Raum arrangieren müssen) mehr Platz zu geben. Allerdings gibt es noch einige Dutzend Straßenbahnen, bei denen man manchmal eben nur einsteigen könne. Hinzu kommt ein halbes Dutzend »Hochflurwagen«, also solche mit Treppen als ausschließlichem Einstieg. Alle diese Waggons sollen allerdings ab Dezember nach und nach ersetzt werden. Auch bei Bus- und Bahnfahrer*innen gäbe es solche, die auch mal warten oder mehr als nur pflichtgemäß beim Einstieg helfen. Aber halt auch einige, die nicht nahe genug für Behinderte an den Bordstein ranfahren. Tricky auch die neuen autonomen Gefährte, die oft viel zu schnell losführen, bevor sich Blinde überhaupt mal sortiert hätten. Und Rolli-Fahrer*innen? Dürfen vorerst noch gar nicht mit ihnen mitfahren. Auch gäbe es durchaus zahlreiche Stationen, die Blindenleitstreifen oder gute Einstiege für Rollstuhlfahrer*innen haben. Doch ausgerechnet die Großen wie Haupt- oder Konstablerwache seien »ein Graus für Blinde«. Orientierungshilfen quasi null. »Klingt ja auch besser«, so Heiler, »wenn man vermelden könne, fünf (kleine) Stationen umgebaut zu haben als eine große …«. Was dieser »Schweizer Käse« für Behinderte konkret bedeute, beschreibt Heiler am Beispiel Galluswarte. Wer dort mit der engen und unkomfortablen Straßenbahnstation nicht zurechtkäme, müsse stadteinwärts bis zum Platz der Republik für eine weitere behindertengerechte Station weitergehen oder -fahren (letzteres allerdings dann ohne Bahn). Sind ja auch nur zweieinhalb Kilometer … Doch wie gesagt: Verlässt man die Stadt, sieht es oft noch schlechter aus, wird der Ausflug in die Region und ins Grüne »schnell zum Abenteuer«. Gesetze hin, Gesetze her … (sfo.).