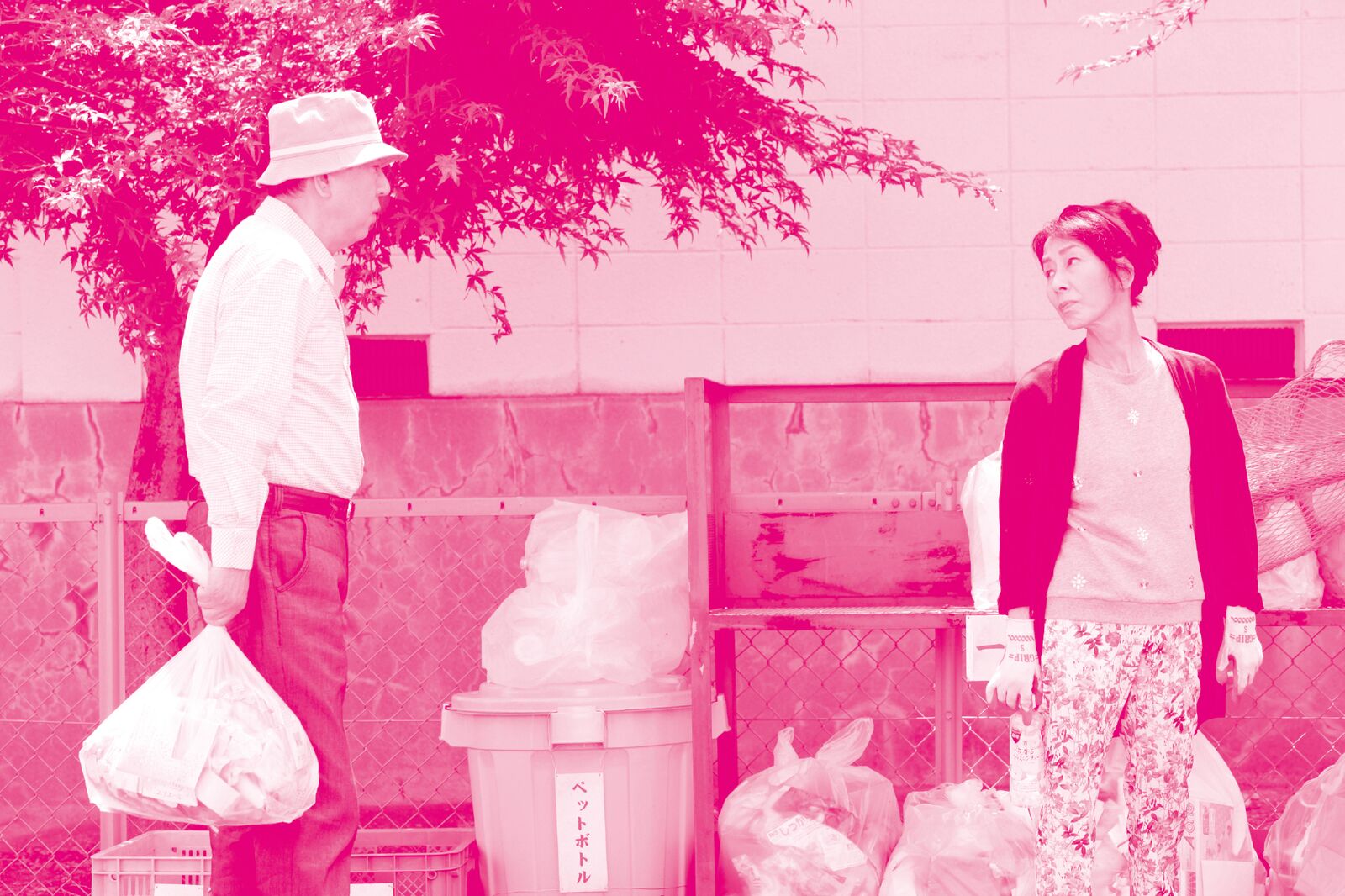»Soziokulturelle Zentren«, in denen meist mehr oder weniger alternativ angehaucht Kultur und Gesellschaft zusammenkommen, werden für eine offene und demokratische Kultur im Lande immer wichtiger. Ein solches Zentrum par excellence ist der Hafen 2 in Offenbach. Er feiert in diesem Jahr sein 20jähriges Bestehen.
Sie gehörten zu jenen Kultur- und Gastro-Orten, die selbst in heftigeren Corona-Tagen eine Chance hatten, zu öffnen. Zumindest, wenn nicht alles geschlossen war. Wo anders schließlich als im Offenbacher Kultur-Biotop »Hafen 2« gibt es sonst Kultur und Chillen mit so viel Auslauf? Weite und Freiraum waren schon immer dessen Markenzeichen – im übertragenen Sinne und auch wortwörtlich. Das gilt für das Programm: von den vielen fremdsprachigen Filmen bis zu coolen Singern und Songwritern. Und es gilt für das Drumherum. Nicht von ungefähr tummeln sich hier vor allem von Frühjahr bis Herbst Familien und Freidenkende, um im gepflegt-alternativen Ambiente eben diese Filme und Konzerte zu genießen oder die Kids im ausufernden Sandkasten und bei Schafen und Hühnern spielen zu lassen.
Nicht von ungefähr hatte sich Hessens damalige Kulturministerin Angela Dorn vor einigen Jahren eben diesen Hafen 2 ausgesucht, um die Verdoppelung der Fördermittel für soziokulturelle Zentren im Lande auf rund zwei Millionen Euro zu verkünden. Nun hat man zwar zuweilen den Eindruck, dass ganz Offenbach in den letzten Jahren mit seinem »Stadtpavillon«, dem Projekt »UND«, den »Kunstansichten« sowie anderer Events ein einziges soziokulturelles Zentrum ist. Doch für »den Hafen« gilt dies besonders. Möglich macht es der in der Region wohl einmalige Open Air-Kino- und Konzertsaal mit echten Tieren, viel Kinder-Freifläche und dem chilligen Blick aufs Wasser. Das kleine Café auf einer Brache im sich wandelnden Hafen konnte so gerade in Corona-Sommern punkten, auch mit viel freiem Grün und dünigem Sand, mit locker gestellten Bierbänken, beweglichen Sonnen-Stühlen und Platz für Picknickdecken. Alles übrigens gepaart mit viel Engagement für Migrant*innen und Flüchtende. Apropos Engagement: Im Jahr 2020 profitierte der Hafen auch vom besonderen Engagement seiner Fan-Gemeinde. Die Filme fanden zwar statt, fielen aber lange als Haupteinnahmequelle bei mühsam die Kosten deckenden 100 Plätzen praktisch weg. Erst später spülten erlaubte 250 Gäste wieder etwas mehr Geld in die Kassen. Konzerte waren – auch wegen vieler Tournee-Absagen – lange praktisch komplett verschoben und fanden erst vereinzelt wieder statt. So startete der Hafen einen Spenden-Aufruf. Der brachte mehrere Zehntausend Euro ein – und den Hafen 2 schließlich zusammen mit einigen öffentlichen Geldern in den folgenden Jahren doch über die Runden. Wobei es zwischenzeitlich allerdings auch schon mal sehr knapp gewesen sein soll …
Seit März hat »der Hafen« nun auch in diesem Jahr wieder geöffnet, unterstützt auch aus dem aufgestockten Etat des Landes und getragen von seinen vielen Fans. Vor allem im Sommer ist er ein echter Place to be. Und bei Nicht-Sommer geht es in den Schuppen nebenan. Vor allem Konzerte und kleine Ausstellungen können dort immer wieder stattfinden. Zwischenzeitlich lebt immer auch mal wieder eine andere Hafen-Tradition auf: die üblichen Fußball-Live-Übertragungen, meist zu EM oder WM gibt es dann im Schuppen oder auch draußen ein Public Viewing. Ein Stück weit ist Hafen 2 aber immer auch Impro-Theater: Was wann so zu erleben ist, muss man stets den aktuellen Ankündigungen entnehmen – egal ob die für das Virus oder die für das Wetter … (vss.).