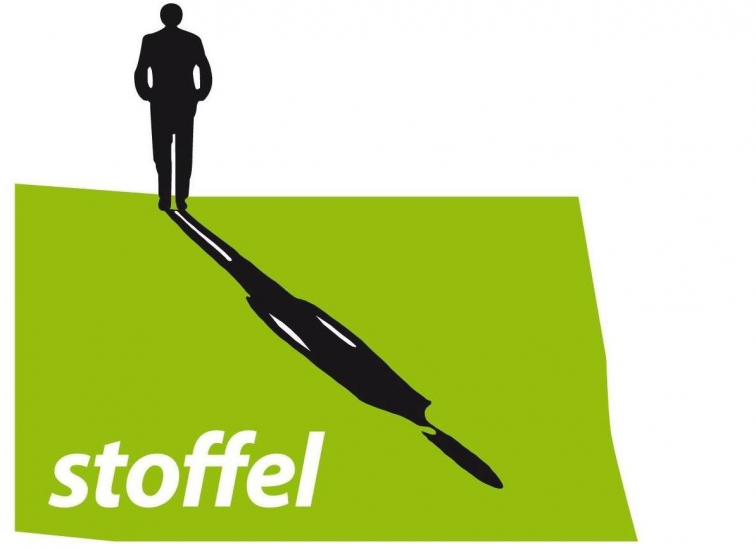Places to be | Eine Neudefinition
In Wohnzimmer-Atmosphären
Stadt braucht mehr Places (einfach) to be
Place to be – ein Begriff, der längst viel zu inflationär genutzt wird. Und bei dem man sich außerdem fragt, ob das, was dahinter steht, eigentlich erstrebens- und anstrebenswert ist. Vielleicht wäre es sinnvoller, ihn auch einmal neu zu definieren – um ihn dann wenigstens mit Sinn inflationär und sehr viel individueller zu nutzen. Nicht als der Platz, wo man/frau sein sollte. Sondern vielleicht mehr als ein Platz oder Plätze, um schlicht und einfach »zu sein«.
Ein Place to be in diesem besten Wortsinn ist der Frankfurter Luisenplatz. Überhaupt einer der faszinierendsten Plätze der Stadt, ist er im Herzen des Frankfurter Nordends fast so etwas wie das Wohnzimmer des Viertels. Jener kreisrunde leicht erhöhte Platz, auf und an dem die Menschen oft in Kleinstgrüppchen beieinander stehen oder auf Bänken, Stufen oder schlicht auf dem Boden sitzen. An dem manchmal abends ein Stand up-Konzert stattfindet, dem diese Menschen auf dem Platz verstreut in der Sonne lauschen. Der nur freitagsabends zuweilen aus den Fugen gerät, wenn Menschen vom nahen Friedberger Platz herüberschwappen. Der Platz ist zugleich der Platz vor dem Lido, dem wohl wohnzimmermäßigsten Café des Viertels, vielleicht der Stadt. Dort, wo durch das Rund des Platzes die Sonne abends am längsten weilt. Das erstaunlicherweise noch nicht von »neuen Nordendlern« okkupiert wurde, das irgendwie fast eine unsichtbare Hülle umgibt. Ein letztes Refugium, obwohl mitten auf dem Präsentierteller? Nicht, dass man dort – in maßvoller Zahl – nicht aufgenommen würde. Aber irgendwie lässt sich dieses unaufgeregte Café einfach nicht gentrifizieren. Ein kleines gallisches Café, wenn man so will. Das Wohnzimmer im Wohnzimmer. Dort, wo man bis vor Corona an der Toilette noch den Hinweis fand, dass hier jeder hineindürfe – und das Sparschwein nur dezent danebenstand. Und wo in Corona-Zeiten tatsächlich Listen geführt wurden – nicht anonyme Mickey-Mouse-Zettel. Kunststück, im Wohnzimmer kennt man seine Pappenheimer*innen …
Ein Platz, der buchstäblich rund ist. Ein Platz, der Ungewöhnliches anzieht, etwa eine der besten Eisdielen der Stadt auf der anderen Seite des Platzes. Ein Platz wie eine Blaupause, wie Leben in der Stadt auch funktionieren kann – und funktionieren sollte. So gesehen ist dieser Luisenplatz ein besonderer Platz in dieser Stadt. Doch eigentlich gibt es gar nicht so wenige solcher Plätze. Unweit etwa der Platz vor der Lutherkirche. In den Wallanlagen nahe dem Eschenheimer Turm der Bürgergarten. Oder ein ganz beliebiges Stück Rasen an der Weseler Werft am Mainufer. Orte der Begegnung, des Miteinander. Aber nicht der Massen. Sondern oft selbst gewählt. Die ganze Stadt könnte aus solchen Orten bestehen – und sie wären angenehmer und sicherer als jedes Opern- und Friedberger Platz-Pendant. Weil sie eben die ungenannten places to be sind. Einfach nur zum Sein und verteilt über die Stadt … (vss.).