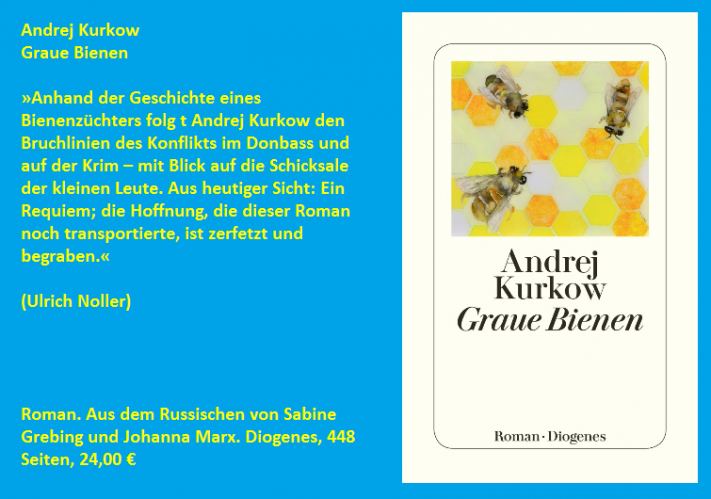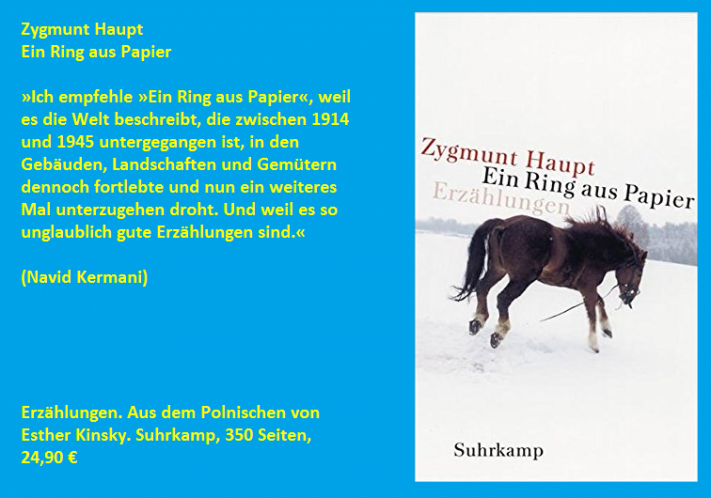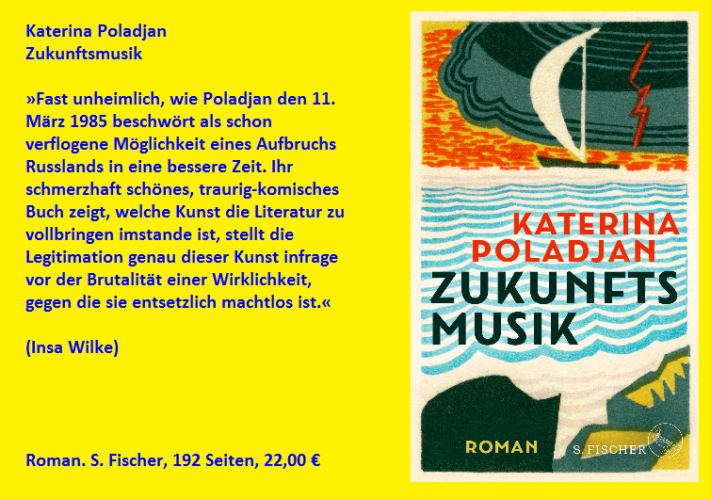Der Frankfurter Verein Litprom versteht viel von guten Büchern. Vor allem von solchen aus dem »Globalen Süden«, die hierzulande bekanntzumachen er sich auf die Fahnen geschrieben hat. Davon zeugt vier Mal im Jahr die Bestenliste »Weltempfänger« mit ausgewählten Übersetzungen aus (fast) aller Welt. Vor diesem Hintergrund wundert es nicht, dass sich die kundigen Juror*innen, selbst ausgewählte Literat*innen und sonstige Büchermenschen, auch der Ukraine und dem russischen Angriffskrieg lesend nähern. Resultat dessen ist eine Sonderausgabe des »Weltempfängers« mit ausgewählten Büchern rund um die Ukraine. Urban Shorts – Das Metropole Magazin präsentiert die belletristischen Fundstücke aus dieser Liste zum Durchklicken. Ein im wahrsten Wortsinn gutes Dutzend guter Bücher. Genau genommen: 13 Bücher von zwölf Autor*innen; ein Autor schaffte gleich doppelt die Aufnahme in diese erlesene Liste … (red.).

Optionen für einen Wandel
Wind, Sonne und Häfen
Spanien - ein europäischer Energiepark?
Rund die Hälfte der deutschen Energie kam bisher aus Russland. Um diese Abhängigkeit abzubauen, schaut man in den Nahen Osten, tauscht aber damit womöglich nur einen Krieg führenden und Menschenrechte verletzenden Diktator gegen einen anderen. Klüger könnte es sein, den Blick Richtung Iberische Halbinsel oder sogar weiter auf den afrikanischen Kontinent zu wenden.
Spanien ist, was seine Energieversorgung angeht, weiter und nachhaltiger unterwegs als viele andere Teile Europas. Rund ein Drittel der spanischen Energie kommt bereits heute aus erneuerbaren Rohstoffen. Strom produziert das Land sogar bereits zur Hälfte aus Energien wie Sonne oder Wind. Beides gibt es schließlich auf der Iberischen Halbinsel zur Genüge. Importiertes Gas wird hingegen nur zu 15 Prozent für die Stromerzeugung genutzt. Wobei Spanien – und Nachbar Portugal – beim Gas sogar fast völlig unabhängig von Russland sind. Der Grund: An den Küsten der Halbinsel liegt fast die Hälfte der europäischen LNG-Häfen, an denen Tanker etwa aus den USA, aus Nigeria oder aus Norwegen Liquefied Natural Gas, also verflüssigtes Gas, anliefern können. Direkt vor Ort wird das Gas wieder in den Originalzustand versetzt und weitertransportiert. Sechs der Häfen liegen an der spanischen, einer an der portugiesischen Küste. Dort könnte ein Teil der jährlich bis zu 50 Mrd. Kubikmeter LNG ankommen, das allein die USA in den kommenden Jahren nach Europa liefern sollen. Die beiden iberischen Nachbarn hatten früher als viele andere europäische Staaten auf diese Häfen gesetzt. Portugal kann damit seinen kompletten Gasbedarf decken. Spanien wäre sogar in der Lage, mit einer Kapazität zur Löschung von 30 Tankern pro Monat einen Teil des Gases nach Europa weiterzuliefern. Ähnliches gilt auch für Solar- oder Windenergie, welche auf oder vor der Halbinsel produziert werden könnten. Spanien nutzt seine Kapazitäten vielfach gar nicht aus.
Nicht von ungefähr sehen Spanien und Portugal nicht nur Chancen für eine eigene Autarkie von russischer Energie, sondern Iberien sogar als Energie-Reservoir oder zumindest Durchgangsstation für Europa. Allerdings hat die Sache bisher noch zwei überraschende Haken. Zum einen ist Spanien so gut wie gar nicht mit dem Stromnetz Resteuropas verbunden. Zum anderen gibt es nur zwei, noch dazu recht leistungsschwache Gas-Pipelines durch die Pyrenäen nach Frankreich, eine dritte endet bei Girona gar im Niemandsland. Doch selbst wenn alle drei Pipelines funktionieren würden, flöße mit gut 15 Mrd. Kubikmetern Gas im Jahr nur ein gutes Viertel des Volumens von Nord Stream I durch diese Verbindungen. Dabei wäre ein Ausbau beider Netze nicht nur kurzfristig ein Gewinn. Sowohl die Häfen als auch die Pipelines könnten langfristig auch für sogenannten grünen Wasserstoff umgerüstet werden. Er ist umweltfreundlicher als das LNG und kann mit Sonne, Wind und Wasser sowohl in Spanien als auch in und um Afrika im großen Stil produziert werden. Deutschland etwa arbeitet zur Zeit gemeinsam mit Namibia an entsprechenden Versuchsanlagen im südlichen Afrika (wenn auch bisher noch ohne eigene Abnahmehäfen in Deutschland selbst). Ganz nebenbei verfügt auch Mittelmeeranrainer Algerien über große Gasvorkommen und könnte über zwei Pipelines ganz klassisch über 20 Mrd. Kubikmeter Gas pro Jahr nach Spanien pumpen. Allerdings ist dieser Teil des Ganzen politisch heikel, da dazu auch das Transitland Marokko teilweise mit eingebunden werden müsste. Dieses aber liegt wegen der West-Sahara mit Spanien und Algerien im Streit. So oder so könnte die Iberische Halbinsel in Zukunft für die Energieversorgung Europas zunehmend wichtiger werden – sei es selbst als Produzent von Energie oder zumindest als Anlande- und Transitland Richtung Zentral-Europa. Das größte Manko aber: Die Europäische Union müsste vorher kräftig in den Anschluss der Halbinsel investieren. Und eines noch: Angesichts von 155 Mrd. Kubikmetern russischen Gases, das 2021 alleine in die EU floss, werden die Anlagen Iberiens alleine das Energie-Problem Europas nicht lösen. Aber laut Fachleuten sollen sie gemeinsam mit den Kapazitäten der anderen Häfen in Europa rund zwei Drittel des russischen Gases ersetzen können … (sfo.).
Im Schatten der Weltpolitik
Hunderte Menschen – ein Wasserhahn
Das Leben im südafrikanischen Township Alexandra
Ein Wasserhahn in Alexandra, einem südafrikanischen Township bei Johannesburg. So weit, so unspektakulär. Doch in der Siedlung mit ihren vermutlich 400.000 bis 500.000 Menschen teilen sich oft einige Hunderte einen solchen Wasserhahn, ebenso wie ein paar Stunden Strom am Tag oder ein Dutzend Dixie-Toiletten. Die Frankfurter Fotografin Petra van Husen, die selbst drei Jahre in Johannesburg gelebt hat, streifte vor drei Jahren mehrfach durch die Siedlung, die für viele Weiße noch heute als No-Go-Area gilt. Ihre Fotos erzählen von der Enge, dem Leben und dem Optimismus der Menschen, von Hütten, Hostels und schwieriger Hygiene, von kleinen Läden, Schuhputzern und 80 Kindern in zwei Räumen. Dies alles nur fünf Kilometer von Sandton entfernt, dem teuersten Geschäfts- und Shoppingviertel des afrikanischen Kontinents. Ein Blick in eine Welt, die nicht nur in Zeiten von Corona nachdenklich stimmt … (red.).

Flucht hat viele Gründe
Kein Brot aus Erdbeeren
Gastbeitrag von Radwa Khaled-Ibrahim
Der Krieg in der Ukraine geht weit über das Land hinaus. Wenn Russland in seinen Nachbarstaat einmarschiert, hat dies Folgen für die ganze Welt. Für Urban shorts beschreibt Radwa Khaled-Ibrahim von medico international, wie sich der Krieg auf andere Länder auswirkt, Krisen und Missstände verschärft, Menschen aus ihren Ländern treibt. Mit Putins Krieg wird etwa der Hunger in vielen Teilen der Welt zunehmen.
»This will be hell on earth«. Es ist nicht überraschend, was David Beasley, Direktor der UN-Welthungerhilfe, sagt. Die Zahlen sind erschreckend: 276 Millionen Menschen in 81 Länder erleben bereits eine Hungerkrise. 44 Millionen sind nur ein Schritt entfernt von der Hungersnot. Die landwirtschaftlichen Erzeugnisse der Ukraine und Russlands machen etwa zwölf Prozent aller »calories the world trades« aus; mehr als 30 Prozent des Welthandels mit Weizen, 32 Prozent mit Gerste, 17 Prozent mit Mais und mehr als 50 Prozent mit Sonnenblumenöl, -Samen und -Mehl kommen aus diesen beiden Ländern. Der meiste ukrainische Weizen aus der letzten Ernte wurde bereits exportiert, 30 Prozent liegen aber noch in der Ukraine. Die nächste Haupterntesaison kommt im Sommer, derzeit wäre eigentlich die Saatzeit gewesen (von Anfang März bis Ende April).
Die ersten Prognosen sind verheerend. Es wird damit gerechnet, dass das weltweite Angebot bis zu 50 Prozent bei wichtigen Agrarprodukten wie Weizen, Gerste, Mais, Raps- und Sonnenblumenöl zurückgehen wird. Das trifft vor allem Länder, die ohnehin in den letzten Jahren stark durch unterschiedliche (geo)politische und globale ökonomische Dynamiken geschwächt waren. Das Kriegsland Jemen bezieht mehr als ein Drittel seines Weizens aus Russland und der Ukraine. Die Länder der letzten großen Aufstände – Ägypten, Irak, Algerien, Tunesien, Libanon –, die bereits von Dürre und Inflation betroffen sind, erhalten zwischen 60 und 85 Prozent ihres Weizens aus der Ukraine und Russland. In Ostafrika wird die Dürre durch die – vor allem von uns menschengemachte – Klimakatastrophe Ausmaße wie noch nie erreichen. Außerdem sind die afrikanischen Länder Ghana, Nigeria, Kenia und Somalia große Weizenimporteure. Als Ölimporteur wird Kenia zudem hart von den Sanktionen getroffen, vor allem wegen des überbewerteten Schillings und dem zu erwarteten Handelsdefizit. Es wird erwartet, dass Kenia Subventionen einstellen wird, welche die Benzinpreise künstlich stabil halten. Dies könnte zur Verdrängung von Ausgaben in den Bereichen Bildung, Gesundheit und Infrastruktur führen.
Doch der Hunger ist nur der Anfang. Dies hat zwei Gründe. Erstens kommt der Hunger selten alleine. Oft wird er mit Gewalt (besonders gegen Frauen und Minoritäten), neuen Schuldenkreisläufen, Binnenflucht (mehr als die Hälfte der weltweiten Fluchtbewegungen), Schwächung der Infrastrukturen sowie besonderen Gefahren für Kinder begleitet. Zweitens sind es die globalen politisch-ökonomischen Strukturen, die dieses Ausmaß an Abhängigkeiten erlaubt haben. Häufig genug produzieren die Landwirtschaften vor Ort nicht mehr für den heimischen Markt, sondern für den Export, sind die »globalen Arbeitsteilungen« verhängnisvoll für die Menschen in diesen Ländern. Es ist kein Zufall, dass der Revolutionsruf in Ägypten »Brot, Freiheit, Würde« lautete. Brot kam zuerst, denn da geht es um die globalen Strukturen, die aus einer Grundversorgung Modelle für Profit gemacht haben. Oder, wie die Sudanes*innen in ihren Protesten gerade rufen: »Crops not cotton«. Denn während Baumwolle eines der klassischen Exportprodukte der Region ist und in den globalen Handelskreisläufen gut fließen kann, steht es aber zugleich stellvertretend für die Ausbeutung des Sudans. Ähnlich ist es in Ägypten, nicht nur mit Baumwolle, sondern auch mit Erdbeeren. Doch wie schrieb der ägyptische Soziologe Sakr El-Nour bitter? »Aus Erdbeeren«, so El-Nour, »wird kein Brot gebacken …«.

Bangladesh | Wohnen im Klimawandel [1]
Bengal (Main) Stream?
Bauen gegen Unwetter und Überschwemmungen
Der Klimawandel stellt Architekt*innen weltweit vor neue Herausforderungen. Steigende Meeresspiegel, vermehrte Unwetter sowie sich ausbreitende Hitze und Trockenheit erfordern zunehmend ein anderes Bauen. Dies gilt mittlerweile für fast alle Teile der Welt. Und zumal dann, wenn auch gleichzeitig Ressourcen, Energieverbrauch oder Kosten im Blick gehalten werden müssen. Das führt immer stärker dazu, Anleihen in Regionen und Ländern zu nehmen, in welchen die scheinbar neuen klimatischen Bedingungen schon länger »zu Hause« sind. Eines dieser Länder ist Bangladesh. Das südasiatische Land am Rande des Indischen Ozeans mit vielen tief gelegene Regionen, zahlreichen großen Flüssen und ausgedehnten sommerlichen Monsunregen hat schon immer mit Unwettern und Überschwemmungen zu kämpfen. Außerdem liegen die Temperaturen nicht nur im Sommer oft um die 30 Grad in diesem obendrein stark bevölkerten Land.
Das erfordert in diesem Land und in seiner nur zwei Meter über dem Meeresspiegel gelegenen Hauptstadt Dhaka zunehmend ein neues Denken beim Bauen. Da die Grundprobleme in diesem Lande aber eben keineswegs neu sind, orientiert sich eine jüngere Generation von Architekt*innen immer mehr an einem Mix aus neuem und aus traditionellem Bauen. Die vielschichtige Wander-Ausstellung »Bengal Stream« und das sehr umfangreiche, begleitende Katalog-Buch geben einen Überblick über das Schaffen der Architekt*innen. In einer sehr dichten Schau geht es um innovative Ideen, um Gebäude und Menschen vor Hitze, Unwettern und Überschwemmungen zu schützen. Gebäude – sowohl im Großen wie im Kleinen – werden durch zerklüftete Fassaden oder kleine Fenster gegen die starke Sonneneinstrahlung abgeschattet. Höfe, Wasseranlagen und durchlässige Materialien sorgen für natürliche Klimatisierung, ebenso wie vertikale Durchlüftungen oder begrünte Dächer. Zugleich werden neue mit traditionellen Materialien gemischt, Beton etwa mit Bambus und Ziegel, welche beide in der Region reichlich vorhanden sind. Sehr präsent ist der Wechsel zwischen geschützten und abgeschatteten zu offenen und lichten Bereichen, die einen Gebrauch der Räume je nach Tageszeit und Nutzung zulassen. Der Gang führt durch Moscheen (die aus Platzmangel in die Vertikale gebaut sind) über Schulen (von denen einige in ländlichen Gebieten wie parkhausartige Trutzburgen aussehen und auch gleich Schutzraum gegen Zyklone sind) bis hin zu Wohnhäusern in Stadt und Land. Auffällig der Low-Cost-Gedanke: natürliche Klimatisierung statt Klimaanlage oder eben der bewusste Mix aus günstigen neuen und einheimischen Materialien. Eine Ausstellung und ein Katalog regelrecht wie ein Baukasten oder ein Labor für das Bauen in Zeiten des fortschreitenden Klimawandels – in Bangladesh wie in vielen anderen Teilen dieser Welt … (vss.).

Bangladesh | Wohnen im Klimawandel [2]
Schwimmende Klassenzimmer
Eine hydraulische Schule auf leeren Fässern
Eines der größten Probleme im südasiatischen Bangladesh ist das oft tiefliegende und angesichts des Klimawandels im stärker von Hochwasser bedrohte Land. Die Hauptstadt Dhaka liegt nur sechs Meter über dem Meeresspiegel, entlang des Flusses Buriganga. Während des sommerlichen Monsuns kann dann schon mal ein Drittel der Stadt unter Wasser stehen. Besonders hart allerdings trifft es immer wieder die Ortschaften um Dhaka herum. Alipur etwa ist eine im Zuge der Verlegung traditioneller Gerbereien und anderer Industriegebiete ins Umland entstandene kleine Ortschaft. Die neue Industrie nimmt oft die wenigen guten Plätze. Weite Teile rund um den Ort ist ständig vom Hochwasser bedroht. So kam man für eine privat durch eine in Großbritannien lebende bengalische Lehrerin initiierte Schule auf die Idee schwimmender Klassenzimmer. Die Bausubstanz besteht ausschließlich aus dem in der Region reichlich vorhandenen, günstigen und sehr vielseitigen Bambus, der komplett auf leeren Fässern ruht. Wenn das Wasser in der Monsunzeit von Mai bis September die Schule langsam einschließt, beginnt diese langsam, aber sicher auf dem Wasser zu schwimmen. Der traditionelle Bambus trotzt derweilen Regen und Stürmen, sodass die vier Klassenräume, die durch eine offene Veranda miteinander verbunden sind, fast das ganze Jahr genutzt werden können. Entworfen wurde die Schule vom Neffen der Lehrerin, Saif Ul Haque Sthapati, welcher in Dhaka als Architekt arbeitet (red./dam.).

Bangladesh | Wohnen im Klimawandel [3]
Wie eine tiefer gelegte Insel
Friendship Centre im Inneren einer Dammanlage
Auch das tiefliegende Land im ländlichen und landwirtschaftlichen Gaibandha ist immer wieder von Hochwasser bedroht. Das war auch das Hauptproblem beim Friendship Centre, das noch dazu mit recht kleinem Budget gebaut werden musste. Ein Erhöhen der Anlage um zweieinhalb Meter, damit sie über dem Hochwasserspiegel liegt, war deshalb keine Option. Die erdbebengefährdete Gegend und die geringe Belastbarkeit des schluffigen Bodens kamen dazu. Die Lösung: Die Anlage wurde komplett von einem Damm von zweieinhalb Metern Höhe umbaut und wurde quasi in dieses künstliche Plateau einbeschrieben. Das Gebäude aus traditionellem Ziegel der Region konnte somit direkt auf den bestehenden Boden gebaut werden und schließt nach oben mit dem Damm ab. Im Inneren der Anlage fangen eine Reihe von Maßnahmen die klimatischen Herausforderungen auf. Gegen die sommerliche Hitze setzt der Entwurf auf natürliche Belüftung und Kühlung, was durch (Zwischen-) Höfe und kühlende Teiche sowie die Bedeckung der Dächer mit Erde und Gras ermöglicht wird. Die Menschen können somit zwischen Innen- und Außenräumen wechseln. Auch der natürliche, ausgleichende Baustoff trägt seinen Teil bei. Regenwasser und Oberflächenabfluss werden zudem in einem Netzwerk aus Innenbecken gesammelt; der Überschuss wird in einen ausgehobenen Teich gepumpt, der auch zum Fischen genutzt wird. Die Architektur selbst ist von den Überresten buddhistischer alter Klöster inspiriert sowie von der Siedlung Mahasthan aus dem 3. vorchristlichen Jahrhundert, die sich unweit des Geländes befindet. Strenge Geometrie einerseits und gebrochene Formen andererseits koexistieren in dem Komplex und bilden nüchterne und meditative Räume (red./dam.).